 Schreiben Sie uns:
Schreiben Sie uns:
Neuerscheinungen, Lesetipps, Lieblingsbücher …
Wir freuen uns über kurze Texte oder Verlagshinweise, wenn Sie Neuerscheinungen anzukündigen haben.
Auch weniger aktuelle Lesetipps zu Büchern von Autorinnen oder Autoren aus der Region sind willkommen. Bitte keine Sachbücher außer zum literarischen Schreiben. An die AutorInnen: Bitte nicht selbst schreiben.
Unter dem Stichwort Lieblingsbuch dürfen Sie schwärmen: Welches Buch aus dem Bereich Belletristik (auch ohne regionalen Bezug) hat Sie besonders beeindruckt oder bezaubert?
Für alle Texte gilt: maximal 2000 Anschläge inkl. LZ. Wir behalten uns eine Überarbeitung vor. Ihre Texte werden auf der Startseite unter „letzte Beiträge“ aktuell angeteasert.
Bitte schicken an: redaktion@freiburger-schreibkiste.de.
Lesetipp von Sylvia Schmieder: Markus Beckers „Das Geheimnis der 137“ ist eine fantastische Novelle, in der Normalität und Wahn ineinander kippen.
Das physikalische Grundproblem ist real: Die Zahl 137 beziehungsweise der Bruch 1/137 wirft als „Feinstrukturkonstante“ im Bereich elektromagnetischer Wechselwirkungen ungelöste Fragen auf. Doch für den Physiker Robert Mann ist „Das Geheimnis der 137“ zur Obsession geworden. „Befreit mich!“, schreit er eines Tages in seinem Labor, zerschlägt einen Teil seiner Einrichtung und bricht zusammen.
Kein Wunder, dass er sich in der Psychiatrie wiederfindet. Dort beginnt ein Reigen unheimlicher Auftritte sonderbarer Persönlichkeiten, vom Patienten, der angeblich eine „gefühlvolle Brühe“ mit schaurigem Inhalt kocht, über einen „Flüsterer“, der vorgibt, Robert bestens zu kennen und zu kontrollieren, bis hin zu einer Frau, die meint, sich an einem heiligen Ort inmitten barbarischer Welten zu befinden. Robert spürt, dass dieser Ort ihm nicht guttut und möchte ihn so schnell wie möglich wieder verlassen. Was wir mühelos nachvollziehen können. Nur verschränken sich auch in Roberts Bewusstsein von Anfang an reale und irreale Ebenen, und er erweist sich als Meister des Kleinredens seiner eigenen Wahnvorstellungen. Träume und Wachzustände sind nicht mehr unterscheidbar. Auch seinem Freund Magnus gelingt es nicht, ihn in vernünftige Denkbahnen zurückzuziehen. Gemeinsam mit Mitpatientin Klara verlässt Robert die Psychiatrie vorzeitig, um nach Indien zu reisen. Dort, so glaubt er, wird er mit Hilfe eines mathematisch genialen Gurus endlich das Geheimnis der 137 lösen. Nach einem berührenden Ausflug in eine andere, aber nicht weniger bizarre Welt, landet er dennoch wieder an seinem Ausbruchsort.
Eine „fantastische Novelle“ im doppelten Sinn, die Traum und Wirklichkeit, Wahn und Vernunft unlösbar ineinander verschränkt. Die Welten innerhalb und außerhalb der Psychiatrie geraten ins Schwanken – und finden nicht zum festen Boden zurück. Etwas oder jemand manipuliert uns eigentlich ständig. Oder sind wir es am Ende selbst, die uns so obsessiv an der Nase herumführen? Ein außergewöhnlicher, bemerkenswerter Text zwischen den Genres, bei dem spannend und unterhaltsam Furchtbares in Komik kippt, Komik in Schwere, Schwere in Absurdität … Ein Vergnügen für Menschen mit starken Nerven!
Markus Becker, Das Geheimnis der 137. Novelle. edition federleicht, 2024, 15 €.
Lesetipp von Sylvia Schmieder: Keine leichte, aber lohnende Lektüre. Die Lyrikanthologie „Ah, ein Herz, verstehe“, herausgegeben von Jakob Leiner, versammelt 101 Dichtende aus fünf Jahrhunderten zum Thema Krankheit und Heilung.
Entspannt schmökern kann man eher nicht, in einem Lyrikband, der mit Cholera, Syphilis und Depressionen jongliert statt mit Waldesrauschen und Liebessehnsucht. Ich habe nach der Lektüre nicht unbedingt einen Arzt gebraucht, aber man macht doch viel durch, von totaler Desillusionierung in Bezug auf menschliche Körpersäfte über den Morphiumrausch bis hin zum Wahnsinn vergangener Kriege. Dennoch habe ich die „Gedichte von Heilenden und Kranken aus 500 Jahren“ mit viel Gewinn gelesen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Herausgeber Jakob Leiner, selbst Arzt und Lyriker, vom Vorwort bis zu den „Biogrammen“ am Ende der Anthologie sorgfältig und liebevoll gearbeitet hat.
Zwischendurch fuhr mir der Gedanke durch den Kopf, dass so viel Recherche- und Sammelleidenschaft in Sachen Krankheit und Tod wohl nur ein ziemlich junger Mensch entwickeln (und durchhalten!) kann, der sich von all dem noch weit entfernt fühlt. Trost spenden nämlich auffällig wenige der ausgewählten Verse. Die meisten sehen einfach hin. Und die – für mich – schönsten schaffen es dennoch, mich zum Lächeln zu bringen, wie die der Renaissance-Dichterin Louise Labé, die ihre Gefühle so erstaunlich direkt und modern fließen lässt. Wilhelm Klemm war für mich ebenfalls eine Neuentdeckung: ein so ausdrucksstarker wie witziger Lyriker, der zwischen den Weltkriegen veröffentlicht wurde und dann in Vergessenheit geriet. Oder Alfred Lichtenstein, unter anderem mit „In der Lungenheilstätte“: drastisch, komisch, am Schluss ein eigenwilliger Dreh ins Zart-Poetische. Auch von Erich Kästner und Robert Gernhardt findet man großartige Verse, die nicht jeder kennt.
Am Schluss eine kleine Parade der Krankheiten und Traumata heutiger Dichterinnen und Dichter. Bemerkenswert, wie sehnsuchtsvoll Clemens Johann Setz seinen – verschwundenen – Tinnitus besingen kann. Zwei Texte von Tara Meister, der Spoken-Word-Künstlerin, beenden die Anthologie und beweisen, dass wir alle, gleich welchen Alters, schon jetzt unsere Vor-Tode erleben müssen.
Jakob Leiner (Hrsg.), Ah, ein Herz, verstehe. Gedichte von Heilenden und Kranken aus 500 Jahren. Quintus Verlag,2024, 280 Seiten, 25 €
Lesetipp von Sylvia Schmieder: Poetische Appelle. Der Erzählband „Keiner mehr da“ von Ute Bales zeigt die besondere Stärke der Autorin, Schonungslosigkeit und Sensibilität zu vereinen.
Ute Bales, bekannt als Romanautorin, die mutig und vielschichtig von Vergangenheit wie Gegenwart erzählt, legt mit „Keiner mehr da“ einen neuen Band mit Erzählungen vor, die den Vergleich mit den Romanen nicht scheuen müssen. Ihr unbestechlicher Blick auf die Härte der Realität hat in der kurzen Form sogar etwas besonders Entwaffnendes. Wie alle Texte des Buches nimmt auch die erste Erzählung „Stress“ eine wahre Begebenheit zum Anlass. Ein Vater vergisst seine kleine Tochter für einige Stunden im Auto, was sie nicht überlebt. Dennoch kann man dem tragischen Protagonisten am Ende keinen Vorwurf machen, im Gegenteil. Der detailgenaue Blick auf die permanente Überforderung des modernen Menschen, bis zum Zerreißen angespannt zwischen privater und beruflicher Verantwortung, lässt uns begreifen, wie risikobehaftet der Alltag ganz normaler, gutwilliger Mitglieder unserer Gesellschaft geworden ist.
Auch die mehrteilige Erzählung „Amerika“ zeichnet in feinen Strichen einen eindrucksvollen Protagonisten, der dennoch scheitert. Der Vater eines auswandernden Bruderpaars im 19. Jahrhundert erträgt tapfer Einsamkeit und Armut und bringt es schließlich sogar fertig, eine eigentlich unmögliche Reise zu realisieren, um den beiden das Erbe zu bringen – das ihm unterwegs gestohlen wird. Spätestens in „Alles im Kopf“ wird es dann wunderbar poetisch. Es geht um die musikalische Fantasie und synästhetische Wahrnehmung eines Jungen, der vor dem zweiten Weltkrieg auf dem Land aufwächst und mit seiner Begabung nicht ernst genommen wird. Als seine Musik im Radio gesendet wird, sind die Reaktionen der Dorfbewohner ein schönes Beispiel für den sanften, immer auch einfühlsamen Humor der Autorin. Überhaupt sind unbarmherzige Darstellungen von Ungerechtigkeit und Grausamkeit und innig-lyrische Naturbeschreibungen bei Bales kein sich ausschließender Gegensatz. In der Erzählung „Eine Respektlosigkeit“ zum Beispiel schwebt und schwingt die Eifler Heimat immer mit, was das furchtbare Ende der beiden Mönche umso heftiger wirken lässt.
LeserInnen ihrer Romane werden auch Themen und Figuren aus ihnen wiedererkennen. Dennoch sind die Erzählungen viel mehr als Vorstudien oder „Beifang“, dafür haben sie zu viel Eigenleben. Die ganz großen Fragen werden gestellt: nach Tod und Vergänglichkeit zum Beispiel. Im titelgebenden Text „Keiner mehr da“ weiß der Vater längst Bescheid, während die Tochter noch versucht, die schmerzhafte Wahrheit zu verdrängen:
Irgendwann kommt ihr heim und dann ist keiner mehr da, sagte mein Vater. Ich empfand fast so etwas wie Mitleid mit ihm, dem die Zeit gestundet schien, anders als mir, die ich das Leben noch vor mir hatte. Seine Gedanken berührten mich nicht. Sein Irgendwann lag in einem fernen Dunst, weit hinter dem Mond und allen Planeten.
Wie in einigen ihrer Romane geht es auch in diesem Band viel um die Eifel, ihre Natur, ihre Menschen. Gerade im letzten Drittel betrauern einige Texte die Zerstörung der Natur in ihrem ganzen Schrecken, klagen sie an. Für mich sind solche „poetischen Appelle“ eine besondere Stärke der Autorin Ute Bales, weil es ihr dank ihrer Schreibkunst gelingt, Schonungslosigkeit und Sensibilität zu vereinen.
Ute Bales, Keiner mehr da. Rhein-Mosel-Verlag 2024 255 Seiten, ISBN 978-3-89801-477-9, 13,50 EUR
Lesetipp von Sylvia Schmieder: „Aber sie empfand nichts“. Mit „Die Haut hat kein Gedächtnis“ legt Susanne Konrad ein Buch vor, das sich erzählerisch und wissenschaftlich ungewohnten Themen widmet.
Eine Neuerscheinung des Verlags DeWinter Waldorf Glass zur Frankfurter Buchmesse 2024.
Die Psychotherapeutin Caro hat ein Trauma zu bewältigen: Ihre Tochter ist aus einer Vergewaltigung hervorgegangen, weshalb es ihr schwerfällt, ihr echte, mütterliche Liebe entgegenzubringen. „Die Haut hat kein Gedächtnis“ von Susanne Konrad ist eine ungewöhnliche und mutige Erzählung, durch den begleitenden Essay als autofiktionale Literatur gekennzeichnet. „Sie dachte, wenn ich mein Kind anschaue, dann muss eigentlich eine Gefühlswoge in mir aufwallen. Aber sie empfand nichts.“ Feinfühlig folgt die Autorin den Verästelungen eines nicht vorhandenen Gefühls, das sich nach und nach doch entwickeln kann, weil die Herausforderungen angenommen werden und ein Reservoir an Liebe vorhanden ist. Eine spannende Geschichte, der man immer wieder gerne folgt.
Neben dieser inneren und äußeren Auseinandersetzung mit einer besonderen Mutterschaft erzählt Konrad aber noch viel mehr – fast eine ganze Lebensgeschichte. Es geht um die Liebe zu Thies, einem deutlich älteren Mann, um die Schwere von Alter und Krankheit, die Überforderung der Protagonistin, als ihre Eltern pflegebedürftig werden und sie gleichzeitig Großmutter wird. Erstaunlich genug, dass es der Autorin gelingt, all das immer wieder sinnlich und spontan zu schildern – so wenn Caro endlich, bei einer Abitursaufführung ihrer gesangsbegabten Tochter, zum ersten Mal den für andere Eltern so selbstverständlichen, tiefen Stolz erleben kann.
Auch ihre Liebe zu dem bald schon schwerkranken Thies wird immer wieder sensibel und glaubhaft ausgedrückt. „Sie spürte seinen Verlust, als hätte sich dieser bereits ereignet“, heißt es dazu schon in der Rahmenerzählung. Insgesamt waren es aber vielleicht doch zu viele große Lebensfragen, denen sich die Autorin auf einmal widmen wollte, denn hier und da wurde mir zu viel erklärt und analysiert, zu wenig erzählt, so, wenn es um Jenny Rieger, eine der Patientinnen von Caro geht. Nach einem für meinen Geschmack allzu harmonischen Zusammensein von Mutter und Tochter klingt die Erzählung noch einmal mit einer wunderbar dicht und überzeugend geschriebenen Szene zwischen Caro und Thies aus.
Auf die Erzählung folgt ein Essay: „Autofiktionales Schreiben als Schlüssel zur seelischen Gesundheit“ zeichnet diese – noch relativ neue – Thematik als Forschungsgegenstand nach und gibt auch konkrete Anleitungen zum Schreiben. Als wissenschaftlich entwöhnte Leserin habe ich die ersten Abschnitte als zu ausführlich empfunden. Es lohnt sich aber, durchzuhalten: Wenn es um die Erzählung der Verlegerin Helene Wolff geht – und um die Schlussfolgerungen daraus – wird es noch einmal richtig spannend. Auch die speziellen Voraussetzungen, Gefährdungen und Chancen psychisch belasteter Autoren werden kenntnisreich und überzeugend dargestellt. Ein Buch mit doppeltem Nährwert für die Seele, essayistisch und erzählerisch.
Susanne Konrad, Die Haut hat kein Gedächtnis. Erzählung mit einem Essay zum autofiktionalen Schreiben. DeWinter Waldorf Glass, Frankfurt a.M., 12 €.
Lesetipp von Heide Jahnke: „Dies geatmete Licht“ / „Des gschnupfti liecht“ von Markus Manfred Jung und Bettina Bohn.
Von den Medien (noch) unbeachtet ist in diesem Sommer ein Buch erschienen, dem durchaus größere Aufmerksamkeit zu wünschen ist.
„Dies geatmete Licht“ / „Des gschnupfti liecht“ aus dem Schweizer Verlag Bucher ist Gedichtband und großformatiges Bilderbuch zugleich. Der Mundartdichter Markus Manfred Jung und seine Frau, die Malerin Bettina Bohn sind da, zusammen oder auch allein, durch ihre engste Heimat, den südlichen Schwarzwald gestreift und haben ihre Eindrücke zu Papier und Leinwand gebracht, – ohne sich gegenseitig illustrieren oder interpretieren zu wollen. Entstanden sind im Lauf mehrerer Jahre dreiunddreißig Gedichte, teils alemannisch, teils hochdeutsch und dreiunddreißig zartfarbige Impressionen, die zusammen eine atmosphärische Einheit bilden, die immer wieder dazu einlädt, sich darin zu vertiefen.
Die Bilder, an der Grenze zur Abstraktion, lassen Raum für eigene Assoziationen, und die Verse, vor allem die alemannischen, sollte man schmecken und kauen, um den Schwarzwald darin zu spüren. Es ist ein gelassenes, fast beiläufiges Schauen auf kleinste Veränderungen und Nuancen in der Natur, in der Landschaft und letztlich im künstlerischen Subjekt, das sich als Teil davon versteht; und das gilt wohl für beide Künstler.
Herzstück des Bandes ist das lange Prosagedicht über das Gehen im Nebel: ein wortgewaltiges Stück Mundart-Literatur mit Sogkraft!
Bei den Versen hätte es meines Erachtens der Übertragung ins Hochdeutsche nicht bedurft. Sie werden dadurch im Vergleich zu glatt und nehmen den Originalen etwas vom rauen Schmelz der Mundart. Aber welch ein Reichtum, sich in beiden Idiomen bewegen zu können und welch eine Bereicherung für Leserin und Leser!
Heide Jahnke
Bettina Bohn & Markus Manfred Jung – Dies geatmete Licht / Des gschnupfti Liecht, Bucher Verlag, Limitierte Auflage 333 Exemplare, Alle Bücher nummeriert und handsigniert von Bettina Bohn und Markus Manfred Jung, € 30,00.
Link zum Verlag: https://www.bucherverlag.com/neuerscheinungen/p/bettina-bohn-markus-manfred-jung-dies-geatmete-lichttag-4xcpc
Lesetipp von Sylvia Schmieder: In dem Roman „Am Kornsand“ schildert Ute Bales unbestechlich und einfühlsam die Auswirkungen von Erziehung und Gesellschaft auf nachfolgende Generationen.
„Die Geschichte fängt an, lange bevor Helga geboren wird, und sie hat kein Ende. Sie fängt auch nicht mit Helgas Eltern an, eher mit den Großeltern, aber das ist ungewiss. Jedenfalls fußt die Geschichte auf einem ganzen Jahrhundert (…)“
Der Einstieg, eine Art Prolog, hat mich gleich für diesen Roman gewonnen. Sensibel und mit geschicktem Spannungsaufbau wird die Hauptfigur Helga beim Namen genannt und doch noch nicht wirklich eingeführt. Dafür klingt schon das zentrale Thema des Romans an: die Auswirkungen von Erziehung und Gesellschaft allgemein, von Kriegstraumata im Besonderen, auf nachfolgende Generationen. Der Roman basiert auf genau recherchierten, wahren Ereignissen, wenn die Figur Helgas und ihre Erfahrungen wohl auch frei gestaltet wurden.
In den folgenden Abschnitten des Prologs zeichnet Ute Bales mit kräftigen, präzisen Strichen das Panorama des gerade endenden Zweiten Weltkriegs, und zwar von einem ganz bestimmten Ort aus: ein Stück Rheinufer bei Nierstein, genannt „Am Kornsand“. Hier wurden im März 1945, wenige Stunden vor dem Eintreffen der Amerikaner, sechs wehrlose Zivilisten auf Befehl von zwei Vorgesetzten der Wehrmacht durch Genickschuss getötet – ohne jede Untersuchung, nur weil sie ihnen irgendwie suspekt waren. Der Mörder war ein Achtzehnjähriger: Helgas Vater Hans. Er hätte sich weigern können, mehrere Kameraden haben das getan. Er aber hielt die Liquidierung für logisch und moralisch richtig.
Hans wurde nach dem Krieg zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt und nach sechs Jahren vorzeitig entlassen. Helga, seine Tochter, erfährt von alldem lange nichts – und bekommt doch zu spüren, dass mit dem Vater, der Familie, ja im Grunde der ganzen Umgebung etwas nicht stimmt. Sie hat Albträume. Wegen eines unheilbaren Hautausschlags kommt sie in ein „Verschickungsheim“, das in seinen sinnlosen, kalten Regeln noch ganz in den alten Erziehungsmethoden erstarrt ist. Endlich wieder zuhause, darf sie nichts Negatives erzählen, sich nicht beklagen. Dass ihr Hautausschlag noch immer nicht verheilt, wird als bösartiger Trotz gedeutet. Sie nehme sich zu wichtig, heißt es.
Parallel zu Helgas Geschichte wird die Jugend ihres Vaters Hans geschildert. Er lässt sich von den Nationalsozialisten faszinieren, weil sie seinen Tagen Struktur und Ziel geben, ihm über pubertäre Selbstzweifel hinweghelfen. Der absolute Befehlsgehorsam wird zu einer Art Ersatzreligion. Ute Bales ist eine unbestechliche Erzählerin. Sie hat den Mut, harte Realitäten, auch die Schwächen und unsympathischen Züge ihrer Charaktere schonungslos darzustellen, ohne sie zu dämonisieren. Wirklich warm bin ich mit Hans deshalb lange nicht geworden. Gegen Romanende aber, in der Schilderung von Prozess und Haft, taucht die Erzählung in tiefe Schichten der Einfühlung. Der noch immer sehr junge Mann ist ganz und gar verunsichert. Seine Einsamkeit, die hilflosen Sehnsuchtsbilder, viel innere Leere, Scham und Angst werden unmittelbar geschildert, und plötzlich ist klar, warum er all diese Erfahrungen später nicht mitteilen konnte. So wird sich Helga aus eigener Kraft von all dem Unsagbaren ihrer Jugend befreien müssen.
Ute Bales, Am Korsand. Roman. Rhein-Mosel-Verlag 2023, 200 Seiten, ISBN 978-3-89801-465-6, 22,80 EUR
Lesetipp von Sylvia Schmieder: In Wahrheit eine/ganz und gar unpathetische Ruhe. Zu Jakob Leiners Gedichtband „Gewetter“.
Der 1992 geborene Arzt und Lyriker Jakob Leiner hat mit „Gewetter“ seinen vierten Gedichtband vorgelegt. Diesmal sind es lyrische Notizen zu Reisen, überschrieben schlicht und sachlich mit Datum, Ort und Uhrzeit – etwas wie ein poetisches Tagebuch also, aus Orten quer durch Europa, darunter auch aus der Freiburger Regio. Das Thema in Variationen: Mensch und Natur(-zerstörung). Da gibt es Berichte zu Wanderungen mit so unprätentiösen wie treffenden Versen wie Was dieser Tag gebracht hat/in der Tasche/5 Steine/in Wahrheit eine/ganz und gar unpathetische Ruhe. Auch leichte, verspielte, humorvolle Gedichte wie die über den Schwarm der Störche, die „in sorgsamer Spirale“ steigen, um dann zusammen wieder zu fallen aus bleierner Luft. rum/wa fragt sich der mit ihnen fallende Beobachter, um sich selbst zu antworten: irgendwas mit dem Wetter/muss es sein. Andererseits bleibe ich an intellektuell-spröden Versen hängen, wissenschaftlichen Fachbegriffen, assoziativ Verrätseltem, das mir die Lesefreude nimmt, weil ich den Verdacht nicht loswerde, dass es sich bedeutsamer gibt, als es ist. Warum es sich für mich unbedingt gelohnt hat, dranzubleiben? Wegen dieser speziellen Mischung aus trockener Ironie und sinnlicher Begeisterung, wegen Versen wie diesen über das „Castello di Duino, bei Trieste“:
unter donnernder Bläue/Gellen des obersten Reihers/der sich in die Adria stürzt/hier wird es begrüßt/von Engeln zu reden/wie ein Licht das alle/Helligkeiten trägt/als altes Flüstern/fortgetragen/die Adern voll Dasein. (…) aber bitte/nicht so stürmisch.
Jakob Leiner, Gewetter. Gedichte. Qintus-Verlag Berlin, 2022, 18 €.
Lesetipp von Ute Bales: „zusammen bleiben“ von Sylvia Schmieder ist ein berührendes Portrait einer Zeit und seiner Menschen, das unter die Haut geht.
Erstaunlich, was sich erleben lässt, wenn man die eigene Familiengeschichte durchforscht.
Sylvia Schmieder beginnt ihren 324 Seiten starken fulminanten Familienroman mit einer heiteren Szene: Die Großmutter breitet die Arme aus und Claudia, die Enkelin, rennt in sie hinein „wie ein Pfennig in einen Magnet.“ Diese beiden Frauen bilden die Klammer des Romans, der sich dann in 30 Kapiteln entfaltet. Die Großmutter Mari, die im Dreiländereck Ungarn-Slowakei-Österreich aufwächst, will Schriftstellerin werden. Ihr Mann Ludwig hat andere Dinge im Kopf. Die Nazis bieten ihm Perspektiven und Mari zieht mit ihrem Mann und den Kindern nach Frankfurt, bereut aber bald, ihm gefolgt zu sein. Es sind nicht nur der Krieg und Ludwigs Arbeit bei der Waffen SS, sie vermisst ihr Land und ihre Sprache. Als Ludwig eine Affäre beginnt, geht sie zurück in die Slowakei. Dort wird 1944 ihr Bruder Peter wegen seiner kritischen Berichterstattung als Journalist von der Gestapo verhaftet und nach Mauthausen verschleppt. Etwa zeitgleich beteiligt sich Ludwig an Massenerschießungen in der Ukraine.
Der andere Strang des Romans erzählt die Geschichte der Enkelin Claudia, die nicht nur von der Sprachenvielfalt der Großmutter fasziniert ist. Für sie ist die Großmutter ein Anker, eine „Menschenmischerin“, wie sie sie nennt, die sich, wie niemand sonst, auf die Kunst der Worte versteht. Wenn sich die Großmutter mit ihrer Familie unterhält, dann sind sie „die Familie mit den besonderen Wörtern“. Die Großmutter ist auch diejenige, die Kraft gibt: „Wenn sie sich umarmten, schossen Claudia die Kräfte nur so in die Glieder, dass sie gleich weiterlaufen musste, die Fäuste ballte und schrie ….“ (Seite 5) Eine der Schlüsselszenen des Romans findet sich gleich zu Beginn. Die Großmutter zeigt ihrer Enkelin, wie sie aus dem, was im eigenen Garten wächst, eine Kräuterolle macht: Sauerampfer, Petersilie, Pimpinelle, Schnittlauch, Estragon, Boretsch. „Die Rolle schmeckte scharf, sauer und bitter zugleich, sogar ein wenig Süße steckt in ihr – also schmeckte sie eigentlich nach allem … “ (Seite 11) Diese unterschiedlichen Ingredienzen versinnbildlichen die „Wildnis“ dieser verzweigten Familienkonstellation und Claudia spürt, wie sie beim Verzehr der Kräuterrolle „Teil des Undurchdringlichen, Unverständlichen wird.“ (Seite 12)
Was sich bei der Großmutter als sprachliche und emotionale Energie entlädt, sucht Claudia bei der eigenen Mutter vergeblich. In ihrem Verhältnis gibt es eine Leerstelle, die beide auf unterschiedliche Weise zu füllen versuchen. Die Mutter spricht kaum über Widerfahrenes, obwohl sie Krieg und Flucht erlebt hat. Aufopfernd kümmert sie sich um Claudias behinderten Bruder und spürt nicht, wie die eigene Tochter leidet und zusehends vereinsamt. Überhaupt bemerkt niemand die Nöte des Mädchens, selbst dann nicht, als Claudia eine Magersucht entwickelt. „Sie trank auch nur noch Wasser, das fiel gar nicht auf. Gar nichts von all dem fiel auf, wie immer, ihre Mutter hatte andere Sorgen, ihr Vater war bei der Arbeit oder spielte Klavier und ihre Geschwister verstanden nichts, ganz wie sie selbst“. (Seite 203).
Mit den Frauenfiguren ihres Romans gibt Sylvia Schmieder dem Krieg ein weibliches Gesicht. Auf gewisse Weise ist das Buch der Versuch, zwischen drei Generationen zu vermitteln. Indem die Autorin Szenen aus dem Alltag herausgreift, kleine Momente und Episoden, Streitereien und Wortwechsel, Sorgen, Nöte und verpasste Gelegenheiten, lotet sie gleichzeitig die Untiefen der Lebensumstände aus, das nicht zu Verstehende, das Unergründliche, die Risse, die sich durch die Familie ziehen. „Er steht langsam auf, zieht sich in sein ehemaliges Arbeitszimmer zurück und kramt in den Resten seines Bündels, dessen brüchige Schnur er gestern mit eine unheimlichen Mischung aus Seufzen und Stöhnen zerrissen hat.“ (S. 297)
Sylvia Schmieder erweist sich mit ihrer bilderreichen Sprache als feinsinnige Beobachterin: „Sie sieht einem Amselpärchen auf dem Rasen zu, wie es nasse Blätter beiseite wirft, Würmer pickt. Sie hört dem Wasserhahn zu, der tropft, aber ganz langsam, während es sich draußen einregnet. Es ist, als bekäme das Haus eine Gänsehaut.“ (Seite 83)
Der opulente Roman, akribisch recherchiert, zeigt die Auswirkungen der NS-Zeit bis in die dritte Generation und macht deutlich, dass die Geschichte von Nazi-Diktatur und Holocaust Menschheitsgeschichte ist. Niemand kann sich herausnehmen, jeder leidet für sich. Ganz besonders, wenn die Auseinandersetzung fehlt. Die Kapitel fügen sich am Ende zusammen und zeigen, wie fest, aber auch wie zerrissen Familienbande sein können.
Was Claudia betrifft, so ist am Ende klar: Ohne den Krieg und seine Folgen wäre aus ihr ein ganz anderer Mensch geworden. Was macht uns schließlich zu dem, was wir sind?
Im letzten Kapitel verneigt sich die Großmutter mit einem anrührenden Satz vor ihrer Enkelin: „Das war ja ein Stückchen Leben, du konntest es nur nicht richtig erkennen …“ (Seite 320)
„Zusammen bleiben“ ist ein berührendes Portrait einer Zeit und seiner Menschen, das unter die Haut geht. Unbedingt empfehlenswert.
Lesetipp von Sylvia Schmieder: „Als bei Bruno Lenkovich einmal die Zeit stehen blieb“ von Werner Leuthner. Kurzgeschichten über Tod und Zuversicht.
Das hat wohl mit den vielfältigen Lebenserfahrungen des Autors zu tun. Werner Leuthner, 1942 in München geboren, hat mehrere Ausbildungen durchlaufen, unter anderem zum Maschinenschlosser und Diplompädagogen. Seine letzten Jahre war er Studienberater der Fern-Universität Hagen. Mit dem Schreiben begonnen hat er erst mit seinem Renteneintritt – und hat immer wieder den Austausch gesucht, gelernt, neue Erfahrungen gewagt, ganz wie seine Figuren.
Werner Leuthner, „Als bei Bruno Lenkovich einmal die Zeit stehen blieb“. ISBN 9-783735742735. Erhältlich u.a. über Amazon, LovelyBooks, BoD und den örtlichen Buchhandel.
Lesetipp von Norbert Gehlen: „Im Kielwasser der Zeit“ von Maria Bosse-Sporleder
Überlebenskünstler im wogenden Meer der Geschichte
Mit ihrer Stimme, die mal zart, mal kraftvoll klingt, zieht die ältere Dame die Zuhörerinnen und Zuhörer gleich in ihren Bann. Die „Kulturkapelle“ in Freiburg-Günterstal bietet einen würdigen Rahmen für diese Lesung, zu der sich etwa 25 Menschen eingefunden haben. Schwer zu glauben, dass die Frau, die da aus ihren „autofiktiven Geschichten“ vorliest, bereits 90 Jahre alt sein soll! „Im Kielwasser der Zeit“ hat Maria Bosse-Sporleder ihr neues Buch betitelt. Ein treffender Titel für eine Geschichtensammlung, die nicht nur die halbe Welt von Russland bis nach Kanada durchmisst, sondern auch anderthalb Jahrhunderte von der Mitte des 19. bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts.
Eine Schiffsreisende zwischen sehr unterschiedlichen Welten erzählt da von ihrer Kindheit in Tallinn (damals Reval, in Estland), von deutscher und sowjetischer Besatzung, von Flucht und Emigration, vom Studium in Kanada und Frankreich, von beruflichen Stationen als Dozentin für deutsche Sprache und Literatur in Finnland und Kanada sowie von wiederholten Reisen zurück zu den hinter ihr liegenden Schauplätzen ihres bewegten Lebens. „Herkunft“ – so sind ihre Erkundungsreisen in die Vergangenheit ihrer Familie überschrieben. Gleich zu Beginn stehen „weiße Servietten“ symbolisch für eine mit Kindermädchen und Köchin gut situierte Familie von selbstständigen Kaufleuten, in die sie hineingeboren wurde.
In einer der Kindheitsgeschichten erinnert sie sich an die sonntäglichen Besuche ihres Großvaters väterlicherseits – da erscheint vor ihrem inneren Auge seine große Gestalt mit schwarzem Mantel und Pelzmütze, auf schneebedeckter Straße. Er hält im Arm eine Tüte mit leuchtenden Orangen, „weil die gut sind für die Kinder“ – sie sind damals so kostbar, dass man sich normalerweise nur zu Weihnachten eine Orange gönnt. Solche Bilder sind es, die den oft mit überraschenden Wendungen aufwartenden Geschichten Leben und einen gewissen Glanz verleihen.
Ihr siebter Geburtstag: Erinnerungen an den Geburtstagstisch mit weißer Spitzentischdecke, an den Schulranzen aus Pappe als Geburtstagsgeschenk, an unbeschwerte Spiele im sonnigen Garten – es ist der 27. September 1939, bald soll sie in die Schule kommen, aber an diesem Tag erliegt das lange umkämpfte Warschau dem Ansturm der deutschen Wehrmacht: „Nicht ahnte ich, dass – kaum fünf Wochen später – wir mitsamt Pappranzen und unserer gesamten Habe auf einem Schiff den Hafen Revals verlassen würden, einem drohend unbekannten, einem Umsiedlerleben entgegen.“
Solche Einzelepisoden aus der Kindheit oder von späteren Reisen in die alte Heimat wechseln ab mit den rekonstruierten Kurzbiografien ihrer Eltern und Großeltern, die so spannend und ungewöhnlich verlaufen, dass man ihnen staunend folgt. Und wo es an Fakten mangelt, ergänzt sie die Lebensgeschichten mit ihrer Vorstellungskraft. Da ist zum Beispiel das Leben des Großvaters mütterlicherseits (1858–1938): erfolgreicher Geschäftsmann, bekleidete öffentliche Ämter, erkrankte an Tuberkulose. Nach der Heilung in Davos: Weltreise über Kanada, USA, Japan, China, Indien, Ägypten und Italien in die Schweiz. Ein Foto von dieser Reise zeigt ihn als „Lichtgestalt mit weißem Anzug und Tropenhelm neben einem … Inder, der einen Elefanten führt.“
Als noch dramatischer beschreibt die Autorin das Leben ihres Vaters (1889-1971): Der Ingenieur für Schiffsbau macht auf seiner „Jungfernfahrt“ über den Äquator Heizerdienst tief unter Deck, vier Stunden Kohlen schaufeln. Jahre später, als Juniorchef der Seeversicherungsgesellschaft in Tallinn, wird er mit einem Notruf an Bord eines im Hafen auf Grund gelaufenen Schiffs gerufen – und lässt dafür seine Braut eine Dreiviertelstunde vor dem Traualtar warten … Es sind immer wieder solche Wechselfälle des Lebens, Fügungen, Anekdoten, mit denen die Autorin Farbe in ihre Geschichten bringt.
1941: Während seine Familie bereits 1939 Estland verlassen hat, hält der Vater die Stellung in der väterlichen Firma. Dann wird auch er von den Sowjets zur Umsiedlung gezwungen und muss bei der Gepäckkontrolle mit ansehen, wie ein Kommissar stapelweise Dokumente aus seinen Aktenordnern reißt: Da liegen dann sämtliche Belege für seine zurückgelassenen Besitztümer am Boden der Zollbaracke verstreut.
1942: Auf Geschäftsreise in Berlin wird der Vater eines Nachts von der Gestapo verhaftet. „Die peinigende Sorge: Er hat Hitler-Witze erzählt, von seiner kritischen Haltung keinen Hehl gemacht. Erst nach Wochen die Klärung: Er wird eines Wirtschaftsverbrechens bezichtigt, das gar nicht stattgefunden hat.“
Nach dem Krieg landet er mit seiner Familie zunächst als Flüchtling im deutschen Bad Kissingen; dann Weiterreise zu Verwandten nach Kanada. Jobs als Lagerverwalter, Tellerwäscher, schließlich Existenzgründung als Fotograf, mit Fotostudio im Wohnzimmer und Labor im Bad. Man kann sich nur wundern über diesen Überlebenskünstler, dessen Tod die schreibende Tochter mit bewegenden Worten beschreibt: „Am Spätabend noch eine Morphiumspritze. Seine Augen sind weit offen; er sieht etwas, was die Tochter nicht sieht. Sie hört ihn Worte formen, erkennt den Namen seiner Heimatstadt. Früh morgens ist sie kurz eingenickt. Wird sie wach, weil sie seinen Atem nicht mehr hört?“ Kein Wort zu viel, da zeigt sich die sprachliche Kunstfertigkeit der Maria Bosse-Sporleder.
Weniger interessant für mit Tallinn/Estland nicht vertraute Leser sind die Besuche der Autorin in den Straßen und Häusern, wo sie früher gewohnt hat. Aber dann folgt da überraschend eine stilistisch interessante Textform: „36 Sätze über meine Mutter“. Kein zusammenhängend erzählter Lebenslauf, sondern einzelne Protokollnotizen, die dramatische Erlebnisse oder persönliche Charakteristika dokumentieren:
„Sie floh mit ihrer Mutter und ihren beiden jüngeren Schwestern 1918 vor den Bolschewiken nach Berlin …
Sie vergaß, panisch vor Sorge um ihre kranke Tochter, auch nur das Geringste zum Essen einzupacken, als die Familie am 20. Januar 1945 vor den Sowjets flüchten musste …
Sie stürzte sich als ‚landed immigrant‘ in Montreal mit den 50 Dollar Handgeld zum Einkauf in den Supermarkt, ohne ein Wort Englisch zu können.“
Allerdings: Weniger – also die Verdichtung, die Verkürzung auf 25 Sätze – wäre hier mehr gewesen.
Stilistisch originell auch der Text über die „Kleider meiner Mutter“: Sie erinnert sich an eine silberne Gürtelschnalle … „und plötzlich ziehe ich aus den Tiefen meines Bewusstseins … die Kleider meiner Mutter hervor. Und hänge sie auf die Leine meines Schreibens, jetzt. Da ist das luftige Sommerkleid … Da ist das Herzdame-Kleid zum Kostümball … Das schwarze Kostüm. Ich betrachte es auf dem Passfoto, das sie wohl machen ließ, als sie 1939 Estland verlassen musste. Sie sieht sehr respektabel darin aus. … Es wird in meinem Kleiderschrank hängen bleiben. Für wen?“
Den kleineren zweiten Teil des Buches bilden mal längere, mal kürzere Erzählungen von „Begegnungen“. Teils in der Ich-Form, teils in der dritten Person – ob die Autorin dies alles selbst erlebt hat, bleibt offen, ungesagt, bleibt in der Schwebe, wie so manches in ihren Geschichten. Da beschreibt sie beispielsweise die Vorgeschichte eines ersten Rendezvous im Kindesalter, wobei es erst im letzten Satz zu der ersehnten Begegnung kommt. Oder sie erzählt von Begegnungen mit einem ihrer Professoren über 30 Jahre hinweg, eine Freundschaft, die erst beim letzten Zusammentreffen in einer vorsichtigen Umarmung gipfelt.
Es geht meist um kurze, aber intensive Begegnungen, bei denen sich Nähe einstellt, in denen emotionale Spannung oder wortloses Verstehen, in denen Anziehung mitschwingt. Mal gibt es nur ein einziges Zusammentreffen, mal wiederholte Treffen in verschiedenen Lebensaltern, wie bei Robert: „Sie hatten sich aufeinander zu geschrieben, einander verschrieben.“ Das liest sich wie der Beginn einer Paarbeziehung. Dann jedoch, kurz bevor es ernst wird: „Urplötzlich hat ihre Welt sich gedreht; nichts ist mehr, wie es war … Nicht in Roberts Arme fallen, nein! Er wird fassungslos sein, traurig, verletzt. Sie weiß es. Und doch wird sie das Unerhörte tun, sich selbst um eine Überraschung voraus. Frei.“ Trotzdem wird daraus eine lebenslange Freundschaft.
Vor Anker gegangen ist Maria Bosse-Sporleder schließlich in Freiburg: als Dozentin für Deutsch an der PH, als Leiterin von Schreibwerkstätten (seit 40 Jahren!), als Lyrik-Kolumnistin bei der Badischen Zeitung und als Buchautorin: „Im fünften Koffer ist das Meer“ (2012) Auch sie eine Überlebenskünstlerin – nicht zuletzt mit Schreiben als Überlebensstrategie, so möchte man vermuten. Ein wechselvolles Leben, reich an Begegnungen und an Eindrücken aus den verschiedensten gesellschaftlichen Kontexten.
Was bleibt als Ertrag des Buches haften? Den Schilderungen der „Begegnungen“ gemeinsam ist ein feines Gespür für das Verbindende zwischen den Menschen, für das, was unausgesprochen mitschwingt, für Resonanz (oder deren Abwesenheit) – eine Anregung für die Leser:innen, bei eigenen Begegnungen darauf mehr zu achten und ein ähnliches Gespür zu entwickeln. Eine solche Klammer und Essenz vermisst man bei den Geschichten über die Herkunft, die familiäre Vergangenheit der Autorin. Sie verbleiben weitgehend auf der Ebene der nostalgischen Rückschau, der privaten Spurensuche, der Sammlung von Erinnerungen, der ehrenden Nachrufe. Warum sollte man sie heute lesen? Wünschen würde man sich – als Destillat reicher Lebenserfahrung – so etwas wie Orientierungsbojen oder Halteseile für unser eigenes Überleben im Strudel der Herausforderungen, im alles mitreißenden Kielwasser unserer Zeit.
Im Kielwasser der Zeit. Autofiktive Geschichten, 176 Seiten, Derk Janßen Verlag, Freiburg 2022
Lesetipp von Sylvia Schmieder: Wenn die Heimat schrumpft. In „Die Ungleichzeitigen“ erzählt Philipp Brotz eine wendungsreiche Geschichte mit wunderbar klischeefreien Charakteren.
Hagen, aufgewachsen in einem Schwarzwalddorf, ist ein sensibler, etwas versponnener junger Mann. Sein Vater wollte, dass sich das „Muttersöhnchen“ mit einem Studium im fernen Berlin gegen die raue Realität abhärtet – was gründlich misslang. Kaum sind beide Eltern tödlich verunglückt, kehrt Hagen ins Elternhaus zurück und möchte nur noch mit der Vergangenheit kuscheln. Doch niemand scheint ihn noch zu kennen, niemand interessiert sich für ihn. Und sein Lieblingswald wird für Flüchtlingsunterkünfte abgeholzt. Um „seinen“ Lärchenwald kaufen und erhalten zu können, zockt er panisch an der Börse – und verliert alles. Dass er nicht ganz und gar verzweifelt, hat er unter anderem Adana zu verdanken, einer Jesidin, die ungeahnte Kräfte in ihm weckt.
„Hast du nie das Gefühl, dass in dem, was dich umgibt, deine Heimat immer kleiner wird?“, fragt Hagen seinen Jugendfreund Jochen. Dem ist dieser „rechte Spruch“ so unheimlich, dass er Hagen ironisch an Christian verweist, einen Kollegen, der als ultrarechts gilt. Doch auch Christian wird wenige Seiten später als Charakter für voll genommen und nicht ausschließlich negativ gezeichnet – obwohl er tatsächlich auch rechtsradikale Sprechblasen von sich gibt. „Die Ungleichzeitigen“, im Freiburger 8 Grad Verlag frisch erschienen, ist der dritte Roman des Autors Philipp Brotz. Seine Stärke sind die realistischen Figuren, die nicht in die üblichen Klischeefallen laufen – weder in rechte noch in linke. Gerade die Asylbewerber(innen) werden wohltuend differenziert gezeichnet, keineswegs überhöht und zum Teil auch bewusst in einer unheimlichen Schwebe gehalten – aber ebenso in ihren Stärken gezeigt. Mit den heißen Eisen der Political Correctness geht dieser Roman immer wieder furchtlos um, und sorgt gerade so für wirklich überraschende, auch humorvolle Wendungen.
Philipp Brotz, Die Ungleichzeitigen. Roman. 8 grad Verlag Freiburg, 24 €
Lesetipp von Autor Thomas Berger: Der Roman „Saling aus dem Wald“ von Sylvia Schmieder.
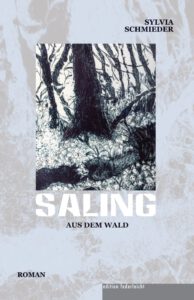
edition federleicht, Frankfurt/Main, ISBN 978-3-946112-70-9
LITERATUR ALS KUNST DES OFFENEN
Gleich die ersten Sätze des Romans Saling aus dem Wald von Sylvia Schmieder, erschienen 2021 im Verlag edition federleicht, locken die Leser in eine geheimnisvolle Sphäre: Ein höchst seltsames Wesen erfährt in unbestimmter waldiger Gegend eine dreimalige (!) Geburt, wird von der Pflanzenwelt freudig begrüßt und gefeiert. „Dann nannten sie ihn Saling. Warum auch immer.“ (9) Wer oder was der solchermaßen Bezeichnete ist, der grammatikalisch im Maskulinum erscheint, bleibt im Ungefähren: „mehr alles als nichts“ (9). Entsprechend vage andeutend ist das Coverbild gestaltet, eine Radierung der in Norddeutschland lebenden Künstlerin O’Liese: Es könnte sich bei dem Ausschnitt eines Waldes um die Bezugnahme auf die Herkunft Salings „aus schwerer Erde, am eisig gurgelnden Bach“ (9) handeln.
An Überraschungen und Sonderbarkeiten ist das Buch der in Freiburg lebenden Autorin reich. So lesen wir beispielsweise, dass Saling sich gern von Täublingen, Kresse und Wasser ernährt, sich aber auch andere an ihm gütlich tun, etwa Igel und Rehe, was die Erzählerin so kommentiert: „Saling hatte seinen Spaß, obwohl es wehtat.“ (10) Auf so gänzlich unvermutete Weise geht es gewissermaßen Schlag auf Schlag weiter. Wir lesen, dass sich Saling verwandeln kann, und zwar mehrfach. Bei Gefahr durch Wildschweine wird er vorübergehend zu einer Flechte, so dass er sich in den Rillenrinden eines Kastanienbaumes zu bergen vermag. Das Zusammenhalten in der Natur klingt als Thema an: Saling glaubt, „etwas wie ein Kastanienlachen zu hören.“ (10) Er begreift seine Verwandlungsbegabung als „Liebe“ (11) und nutzt sie freudig, wird liebend zu einem Farn, einer Schnecke, einer Birke, einem Ameisenbau.
Eines Tages sieht er Menschen, hört, wie sich die Spaziergänger unterhalten. Rätselhaft heißt es: „Ihre Wörter und Sätze fand er in sich vor, nachdem er ihnen lange genug zugehört hatte.“ (13) Als Waldwesen weiß er nichts von menschlichen Behausungen. Er will die in ihm sich ausbreitenden Gedanken an die Menschen und ihre Lebensweise abschütteln, aber es gelingt ihm nicht. Sie setzen sich „mit kurzen, starken Wurzeln von innen überall fest“ (15) ̶ „Efeu“ ist denn auch das erste der zweiundzwanzig Kapitel des Bandes betitelt.
Salings Verwandlungen rühren von seiner geduldigen Einfühlsamkeit her. Als Amsel macht er sich zu den Menschen auf. Doch wie ist er zu einer Schwarzdrossel geworden? „Erst legte er sich zu den alten Amseln in die warmstaubige Erde, spreizte wie sie alle Glieder, blinzelte an denselben Lichtpunkten entlang wie sie. Dann hüpfte er hinter ihnen her. Er warf das Laub herum und pickte, federte vom Boden hoch, vom Ast hinab, hinauf, hinunter, wieder hinauf.“ (14)
Zunächst begegnet Amsel-Saling einem Jungen und einer älteren Frau, die an einer Bushaltestelle warten. Nun wird er zu einem Menschen, genauer: zu einer Frau, wiederum durch hingebungsvolle Beobachtung. „Er sah sich alles genau an. Ihre dunkelroten, struppigen Haare. Ihren rosa Mund. Die Nasenlöcher. Ihr Gesicht war viel heller und faltiger als das des Jungen. Von den Schultern bis auf die Knie trug sie ein grünes Kleid, und die nussharten Schuhe glänzten blauschwarz.“ (16/17)
In der Menschwelt lernt er ihm völlig unbekannte Dinge kennen, zum Beispiel „Gewitterschwärme aus Geräuschen, Gerüchen, Farben, Bewegungen“ (16). Es dauert nicht lange, bis wir merken, dass es sich trotz des märchenhaft anmutenden Charakters des Buches um einen Gegenwartsroman handelt: Handy (17), Notebook (39), Computerspiel (40), Corona (47), Hartz vier (48), SMS (59), weiße Schutzmaske (56), Smoothies (100), Laptop (127), Sozialticket (149), Facebook und Twitter (155), Pandemie (160), Smartphones (163), Internet (164), SUV (171).
Auch wenn er interessiert alles Neue beobachtet und sich darauf freut, bei seiner Rückkehr in den Wald „von den Menschen zu berichten“ (19), sind die Eindrücke, die der Protagonist empfängt doch ambivalent: „Immer wieder zog etwas Salings Blick an und stieß ihn wieder ab, bevor er irgendetwas verstanden hatte.“ (20) Wird er in der Menschenwelt heimisch werden? Früh sehnt er sich nach dem Wald zurück, doch er kennt den Weg dorthin nicht. Und da ist noch etwas: „Der Wald fing damals schon an, auf ihn zu warten.“ (22) Dies ist erneut ein Hinweis auf die Zusammengehörigkeit von Saling und Wald.
Bald verlässt er seine frauliche Gestalt. Er trifft auf einen verzweifelten Mann, der sich anschickt, Suizid zu begehen. Verwundert ruft der Mann aus: „Was bist du für einer, um Himmels willen!“ (27) Saling fragt ihn nach dem Weg zurück in den Wald. Doch dieser vom Leben Erschöpfte vermag ihm lediglich die Richtung zu weisen.
Saling fühlt sich fremd unter den Menschen, und auch ihnen erscheint er zutiefst absonderlich. Auf vielfache Weise bedrängen sie ihn. Einige wollen Fotos machen, eine Journalistin will wissen, ob man ihn als „etwas Außermenschliches“ (75) bezeichnen könne und ob es sich bei den von ihm behaupteten Verwandlungen um „die Fantasien eines Scharlatans“ (76) handele. Sie setzt ihn mit Fragen unter Druck, die auch manchen Leserinnen und Lesern des Romans durch den Kopf gehen mögen: „Ein Fake? Ein inszeniertes, intelligent kalkuliertes Spiel mit uralten Mythen? Mit der Sehnsucht nach dem Aufgehobensein im Schoß von Mutter Natur?“ (76) Saling antwortet nicht. Wir befinden uns im zehnten Kapitel des Buches, also ungefähr in der Mitte. Es ist, als berührten sich hier gleichsam Phantasie und Realität, die Sphäre des Wundersamen und die der Tatsachen. Wenige Seiten zuvor sinniert der Protagonist selbst: „Vielleicht dachte sich sein verrückter Salingkopf alles nur aus, was er sah, wirklich alle seine Erlebnisse und auch, dass er sich verwandeln konnte.“ (73) Sogleich folgt jedoch die interessante Aussage: „Aber wenn er sich nicht verwandeln konnte, war er nicht mehr der, der er war. Dann konnte er nichts, konnte sich nicht einmal selbst ausdenken – oder?“ (73)
Es dürfte sich bei diesem Kapitel um das Zentrum des Romans handeln, welches das gesamte bisherige und nachfolgende Geschehen ins Offene, Uneindeutige hebt ̶ dorthin also, wo das geistige Spiel seinen angestammten Platz in der Literatur hat, in unserem Fall die spielerische Auseinandersetzung mit der Frage der Identität, mit dem Gedanken der Veränderung, der Überwindung des Status quo sowie des Einsseins mit der Natur.
Wie geht es weiter in dem Roman, in den zahlreiche botanische und zoologische Erscheinungen eingestreut sind? Das Interview wird vom Privatfernsehen ausgestrahlt. Saling wird zu einem öffentlichen Phänomen, sehr zu seinem Leidwesen. Menschen locken ihn mit dem Versprechen, ihn in den Wald zurückzubringen. Doch längst ist die Polizei hinter ihm her. Nur mühsam gelingt es ihm, sich ihr dank seiner Verwandlungskunst zu entziehen. Einem Mann, der glaubt, an Leukämie erkrankt zu sein, und ihn fragt, was die Waldwesen in Krankheitsfällen machen, gibt er den ganz allgemein bedenkenswerten Rat: „Nichts ist manchmal mehr als etwas.“ (116) Und wirklich: Der eingebildete Kranke begreift: „ich soll also aufhören, in diesen ewigen Aktionismus zu verfallen, die Krankheit unserer Zeit, das ist es doch. Ich soll aufhören, das Internet zu durchforsten, Medikamente, Therapien, alternative Heilmethoden auszuprobieren, Seminare, Retreats, Vorträge zu besuchen …“. (117)
In den letzten Kapiteln zeichnet sich endlich eine Lösung für Saling ab. Ein Arbeitsloser nimmt ihn in seine Kellerwohnung mit. Sie kommen in ein Gespräch. Saling erscheint als Mensch, verwandelt sich jedoch bald in ein Drachenbäumchen. Als ein solches erkennen ihn die beiden Polizisten nicht, die an der Türe klingeln ̶ „Rechercheroutine“ (160), sagen sie. Der Mieter bringt dem Drachentöpfchen-Saling Verständnis entgegen und bringt ihn im Schutz der „Finsternis“, so der Titel des letzten Kapitels, in den Wald zurück.
Lange brauchen die Waldtiere, ehe sie Saling erkennen. Dieser stirbt nach einer gewissen Zeit ab, wird eins mit der Erde. Und nun wissen die Waldwesen, um wen es sich handelt. Nach wiederum sehr langer Zeit ersteht er neu. Geschickt schafft die Verfasserin einen erzählerischen Rahmen. Auf ersten Seite ihres Textes erwähnt sie eine „alte Buche, die sie die Große Beruhigung nannten“ (9), und auf der letzten Seite beschreibt sie Salings Neuwerdung folgendermaßen: „Er erkannte sie gleich, seine Große Beruhigung, die eben ein Blatt verlor. Gelb, braun, zu dritt, viert lagen sie in der Luft, fielen auf ihn zu, im tiefen Wald, am laubigen Hang. Und Saling schoss hoch auf.“ (173)
Der Protagonist des Romans ist als sympathisches, gutmütiges Wesen gestaltet, das Zärtlichkeit zu empfinden vermag. Anrührend ist zum Beispiel die Episode, in der er auf eine Neunjährige trifft. Die beiden freunden sich in liebevoller Weise an.
Auch sprachlich ist das Buch ansprechend gestaltet. Zwei Kostproben: „Und plötzlich“, lesen wir über den sich in einen Vogel verwandelnden Saling, „lag er auf der Luft! Sie war bachwasserkalt, die Luft, die ihn trug. Flaumig wie Moos strich sie am Bauch entlang, hob ihn hoch in die Kronen, torkelherrlich war das!“ (14) Und ein Ausschnitt aus einer Waldbeschreibung: „Ledern ragten Semmelstoppelpilze, Riesen im Wirrwarr, die einen Himmel bildeten, über dem sich weitere Himmel türmten, ein farblos flirrendes Universum, unergründlich und sehr anstrengend.“ (62)
Für wen ist dieser Roman geschrieben? Für alle, die sensibel genug sind, sich bezaubern zu lassen, und die gleichwohl den harten Boden der Wirklichkeit nicht ausblenden wollen. Für mündige Leserinnen und Leser, welche das Offene und die Mehrdeutigkeit zu schätzen wissen. „Das Lesen ist immer ein Umzug, eine Reise, ein Fortgehen, um sich zu finden“, befand der spanische Schriftsteller Antonio Basanta Reyes. Saling aus dem Wald ist in diesem Sinne ein treffliches Exempel geglückter Literatur und Leseerfahrung ̶ wahrhaft ein jeu d’esprit!
Lesetipp von Renate Schauer: Sarah Moss, Gezeitenwechsel. Spannender Familienalltag.
Bestechend finde ich hier, wie Alltag beschrieben wird. Familienalltag, wohlbemerkt. Konflikt- bzw. Sorgenpotential liefert eine Krankheit, die schwer einzuordnen ist, aber in das Familienleben eingeordnet werden muss: Die 15-jährige Tochter bleibt einige Momente ohne Bewusstsein und ohne Atem. Eine Allegie? Eine Erbkrankheit? Immer wieder bange Fragen: Atmet sie noch? Wird ihre kleine Schwester auch dieses Symptom erleiden?
Es geht also um den normalen Ablauf, in dem eine Brüchigkeit Platz greift, die womöglich sogar lebensbedrohlich ist. Die Mutter eine chronisch überlastete Ärztin, ihr Mann Vollzeitvater und „nebenbei“ Dozent. Aus seiner Perspektive wird die Geschichte erzählt. Die britische Schriftstellerin Sarah Moss, geb. 1975, schlüpft also in den Kopf eines Mannes.
Leider schweift er zu oft ab zum Schicksal der Coventry Cathedral. Was die Planung von deren Wiederaufbau mit dem Schicksal seiner Familie – auch symbolhaft – zu tun haben könnte, erschließt sich mir nicht. Sie streckt das Buch unvorteilhaft. Doch irgendwie muss sich der Vater ja ablenken von der Eintönigkeit der Hausarbeit und den Sorgen um die Töchter. Wenn er die Geschichte seiner Eltern erzählt, ist das logisch und erhellend.
Wir wissen nicht, wie sich die Familienmitglieder letztlich entwickeln. Irgendwann ist diese sorgenvolle Episode auserzählt. Sarah Moss trifft an der richtigen Stelle die Entscheidung, dass wir genug an dem Lebensabschnitt partizipiert haben.
mareverlag GmbH; Februar 2019, 327 Seiten, 24 Euro
Lesetipp: Eva C. Zellers Gedichtband „Proviant von einer unbewohnten Insel“ driftet zwischen Fels und Meer, Wort und Welt.
 Wasser und Land in allen Varianten. Souverän spielt die mehrfach ausgezeichnete Lyrikerin Eva C. Zeller auf verschiedenen Klaviaturen, mal lautmalerisch, mal asketisch karg, erzählend oder meditativ, träumend oder hart an der Realität. Die Betrachterin, Beschreiberin hat ein so einfaches wie großes Ziel: den ausschnitt als welt begreifen/das rätsel vergrößern. Die Natur ist selten nur schön, immer auch verschlossen, grausam, tödlich. Ein vom Verlag sehr hübsch gestalteter Leseproviant, für alle, die sich treiben lassen wollen, um nirgends anzukommen.
Wasser und Land in allen Varianten. Souverän spielt die mehrfach ausgezeichnete Lyrikerin Eva C. Zeller auf verschiedenen Klaviaturen, mal lautmalerisch, mal asketisch karg, erzählend oder meditativ, träumend oder hart an der Realität. Die Betrachterin, Beschreiberin hat ein so einfaches wie großes Ziel: den ausschnitt als welt begreifen/das rätsel vergrößern. Die Natur ist selten nur schön, immer auch verschlossen, grausam, tödlich. Ein vom Verlag sehr hübsch gestalteter Leseproviant, für alle, die sich treiben lassen wollen, um nirgends anzukommen.
Eva C. Zeller, „Proviant von einer unbewohnten Insel“. Gedichte. klöpfer.narr, 20 €
Ein Tipp von Susanne Hartmann: lyrische und gemalte Postkarten als kleine Freiburger Kostbarkeiten.
 Ein Tipp von Dr. Susanne Hartmann, Autorin, Journalistin, Kulturanthropologin
Ein Tipp von Dr. Susanne Hartmann, Autorin, Journalistin, Kulturanthropologin
Die Freiburger Schriftstellerin Sylvia Schmieder hat wunderschön poetische Bilder entworfen, in ihren Gedichten, die wie eine Hommage an die Stadt Freiburg und ihre Umgebung klingen. Untermalt hat diese der Künstler Ulrich Birtel mit sinnlich strahlenden Aquarellen.
Die Bilder zeigen uns Altbekanntes, Überraschendes und mitunter Komisches. Da summt die Altstadt vorbei, wenn jemand in der Straßenbahn durchs Schwabentor fährt. Am Dreisamufer macht ein Riesenkiesel seinen urzeitlichen Rücken rund und ein Mann sitzt lesend in einer Pfütze. An einem See am Schauinsland erscheinen Libellen wie Smaragdnadeln. Doch auch kritische Beobachtungen und Gedanken finden sich in den Gedichten. Wenn etwas hakelt im geschäftigen Treiben oder jemand in seinen Schlafsack hustet. Nicht nur die fein gewobene Poesie Sylvia Schmieders trägt uns durch Freiburg und die Umgebung, sondern auch die ansprechenden kolorierten Zeichnungen Ulrich Birtels.
Fünf Gedichte plus fünf Motive auf je einer Doppelkarte, gefördert vom Kulturamt der Stadt. Zu haben sind die kleinen Kunstwerke in den Freiburger Buchhandlungen Rombach, Jos Fritz, Schwarz (Wiehre) und Vogel (Littenweiler) oder online bestellbar über sylvia-schmieder.de. Sie kosten 2,70 Euro das Stück. Und passen wunderbar zum Verschenken, Aufbewahren, Lesen, Vorlesen und natürlich zum Anschauen.
Lesetipp von Rita Lamm: „Verzauberter April“ von Elisabeth von Arnim.
 Im Februar nahm ich im Vorbeigehen aus einer „Zu Verschenken-Kiste“ ein Buch mit.
Im Februar nahm ich im Vorbeigehen aus einer „Zu Verschenken-Kiste“ ein Buch mit.
Verzauberter April von Elisabeth von Arnim.
Ein mediterraner Frühlingstraum
An jene, die Glyzinen und Sonnenschein zu schätzen wissen. Kleines mittelalterliches Castello an der italienischen Mittelmeerküste für den Monat April zu vermieten. The Times
Auf diese Anzeige brechen vier ernste englische Damen aus ihrem Alltagsleben im London der zwanziger Jahre nach Italien auf. Dort entdecken sie nicht nur die Verzauberungskraft der prachtvollen Natur, sondern ganz beiläufig auch sich selbst. ( So der Klappentext auf der Rückseite.)
Letztens war mir nach frühlingshafter Verzauberung – und tatsächlich. Diese leichte Lektüre entführte mich erst ins London der zwanziger Jahre und dann bald in den Frühling nach Italien. Der Lockruf der Anzeige, die Vorbereitungen und das Abenteuer des Aufbruchs und der Reise und dann die Tage und Stunden in diesem wunderschönen Castello und dem üppigen Garten am Meer…
Die Verstrickungen und die emotionalen Wandlungen der Damen werden mit viel charmanter und liebevoller Ironie und englischem Witz erzählt. Ich musste zeitweise laut auflachen und wurde mitverzaubert. Wunderbar und nur zu empfehlen.
Ein Geschenk aus der Kiste! Danke!
Lesetipp von Arne Bicker: „Lustprinzip“ von Rebekka Kricheldorf. Selbstfindungsprozess im Berlin der Nachwendezeit.
Gelegeneheit macht Liebe, sagt man, und die Corona-Krise macht Bücher. So simpel erklärt sich das Zustandekomen des Romans „Lustprinzip“ von Rebekka Kricheldorf (Rowohlt). Die gebürtige Freiburgerin lebt in Berlin, ist vielfach ausgezeichnete Theaterdramaturgin und hat in den letzten Monaten mangels Theaterarbeit mal eben einen Roman verfasst. Und dieses Debüt ist ein großer Wurf, die 240 Seiten entfalten eine fast schon unheimliche Wucht und einen schwärenden Lesesog: Larissa, Hauptfigur des Romans, durchlebt im Berlin der Nachwendezeit einen schmerzlich stagnierenden Selbstfindungsprozess zwischen Hausbesetzer-Szene, Berliner Nachtleben und Humboldt-Universität. Die Autorin beschreibt in direkten, unverblümten und fesselnden Worten eine permanente Selbst- und Außenhinterfragung, die sich fortwährend zu drehen und zu winden scheint wie ein Windows-Bildschirmschoner, und wie ein solcher doch nicht vom Fleck kommt. Kricheldorf beherrscht die Kunst, scheinbar Lapidares pulsieren zu lassen, ihre Worte durchlodern förmlich einen fortwährenden Tanz auf einem Vulkan der zum Scheitern verdammten Auflehnung gegen staatliche Autoritäten und bürgerlichen Meinungsbeton – ein Leben, in dem Drogen, Alkohol, Sex und Kultliteratur verschlungen werden wie von einem ewig rastlosen Packman, der stets das gleiche Labyrinth durchstreift, immer auf der Suche nach der nächsten Krafttablette, und stets in Gefahr von überall lauernden Gespenstern pulverisiert zu werden, deren Überzahl erdrückend scheint. „Lustprinzip“ ist Einblick, mitreißende Erzählung, Unentrinnbarkeit, Stakkato der Emotionen und Zustände. Stark.
„Lustprinzip“ von Rebekka Kricheldorf, Rowohlt Berlin, erschienen am 16.02.2021, 240 Seiten, 20 Euro.
Lesetipp: „Mein Amrum“ von Annette Pehnt. Eine sanfte Schule der „genauen Leidenschaft“.
 Ein Buch für Amrum-Liebhaber? Oder – in Covid-19-Zeiten – ein schmaler Reiseersatz? Nicht nur. Annette Pehnts „Mein Amrum“ nennt sich nicht Roman und ist auch keiner, könnte viel mehr poetisch-autobiografischer Reisebericht genannt werden, mit Einschüben zur nahen und fernen Vergangenheit der Insel und der Erzählerin. Das Besondere, Überraschende an diesem Buch ist für mich aber die behutsame Kraft, die es entfaltet, wohl ähnlich der Natur auf der Insel (die ich nicht kenne). Nichts Sensationelles geschieht. Stattdessen ist immer wieder einmal die Rede von unübersichtlich vielen Haupt- und Nebensachen, von der heilsamen Verwechslung des Wichtigen mit dem Unwichtigen, vom bewussten Verlaufen zwischen den Dünen. Gerade in Zeiten eines aufgeregt marktschreierischen Literaturmarktes tut die Zurückhaltung dieses Textes ungeheuer gut. Ich werde zum genauen Sehen eingeladen, zum sorgfältigen Wahrnehmen von Wirklichkeit, statt zur Verklärung, Übertreibung, Effekthascherei. Dabei wird mir nicht zuletzt bewusst gemacht, dass auch das Erzählen die Vergänglichkeit nicht aufhalten kann:
Ein Buch für Amrum-Liebhaber? Oder – in Covid-19-Zeiten – ein schmaler Reiseersatz? Nicht nur. Annette Pehnts „Mein Amrum“ nennt sich nicht Roman und ist auch keiner, könnte viel mehr poetisch-autobiografischer Reisebericht genannt werden, mit Einschüben zur nahen und fernen Vergangenheit der Insel und der Erzählerin. Das Besondere, Überraschende an diesem Buch ist für mich aber die behutsame Kraft, die es entfaltet, wohl ähnlich der Natur auf der Insel (die ich nicht kenne). Nichts Sensationelles geschieht. Stattdessen ist immer wieder einmal die Rede von unübersichtlich vielen Haupt- und Nebensachen, von der heilsamen Verwechslung des Wichtigen mit dem Unwichtigen, vom bewussten Verlaufen zwischen den Dünen. Gerade in Zeiten eines aufgeregt marktschreierischen Literaturmarktes tut die Zurückhaltung dieses Textes ungeheuer gut. Ich werde zum genauen Sehen eingeladen, zum sorgfältigen Wahrnehmen von Wirklichkeit, statt zur Verklärung, Übertreibung, Effekthascherei. Dabei wird mir nicht zuletzt bewusst gemacht, dass auch das Erzählen die Vergänglichkeit nicht aufhalten kann:
Texte: Archive der kleinen Dinge, mit genauer Leidenschaft erfasst, unermüdlich geordnet, bis jedes Detail sichtbar wird. Aber dass sich Staub absetzen kann, dass die Ordnungen in Vergessenheit geraten und die Dinge wieder in ihre Zufälligkeit zurücksinken – das kann niemand verhindern.
Annette Pehnt, Mein Amrum. Mare Verlag, 18€.
https://www.mare.de/buecher/mein-amrum-8293
Lesetipp von Rita Lamm: „Ein Leben mehr“ von Jocelyne Saucier. Drei alte Männer, zurückgezogen in den kanadischen Wäldern lebend, bekommen Besuch.
Von Rita Lamm, Merzhausen. www.ritalamm.de
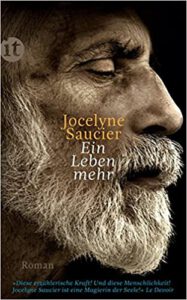 Das Setting: Drei alte Männer haben sich in die kanadischen Wälder zurückgezogen; Tom, der viele Namen tragen könnte, Charlie und Ted. Jeder lebt in seiner eigenen Hütte. Sie gehen Angeln, sitzen zusammen, reden über das Leben und den Tod. Es geht ihnen um die Freiheit sich das Alter so zu gestalten, wie man will und auch über das Ende des eigenen Lebens zu bestimmen, oder eben einen Freund zu bitten, das tödliche Gift zu verabreichen.
Das Setting: Drei alte Männer haben sich in die kanadischen Wälder zurückgezogen; Tom, der viele Namen tragen könnte, Charlie und Ted. Jeder lebt in seiner eigenen Hütte. Sie gehen Angeln, sitzen zusammen, reden über das Leben und den Tod. Es geht ihnen um die Freiheit sich das Alter so zu gestalten, wie man will und auch über das Ende des eigenen Lebens zu bestimmen, oder eben einen Freund zu bitten, das tödliche Gift zu verabreichen.
Eine Fotografin kommt zu ihnen in den Wald. Sie sucht Bildmaterial zu den großen Feuern des vergangenen Jahrhunderts. Sie wird nicht wirklich in der Gemeinschaft geduldet. „Sie habe ja kein eigenes Leben.“ Zu diesem Zeitpunkt war Ted gerade gestorben. Ted, ein Mann, wie eine offene Wunde. Er war der Junge, der bei den großen Bränden eine Woche lang durch die Feuerbrünste getaumelt war. Ted, der unendlich viele Bilder gemalt hatte und immer in die zwei Posson-Zwillingsschwestern verliebt war; eine unerfüllte Liebe.
Dann gibt es plötzlich noch eine alte Dame namens Marie- Desneige.
Sie ist so groß, wie ein zwölfjähriges Kind und ging mit Mäuseschritten.
Sie verbrachte den Großteil ihres Lebens in einer psychiatrischen Anstalt und ist die Tante von Bruno, einem Freund der alten Herren, der die Verbindung nach draußen in die Zivilisation ist und viel kifft. Marie Desneige erhält eine eigene, liebevoll gebaute Hütte.
Charlie und Marie Desneige finden sich und erleben eine zärtliche Altersliebe. So rücken die Gedanken an den Tod und das Ende weit weg.
Die Erzählweisen und Perspektiven wechseln und so entsteht die Geschichte als Ganzes. Es ist ein Mosaik, das sich zusammenfügt. Die Sprache ist zart und liebevoll und doch bildgewaltig. Gerne ist man mit dabei in der Wildnis der kanadischen Wälder und gerne lässt man sich berühren von der Menschlichkeit der Figuren in ihren anscheinend bescheidenen Leben.
Jocelyne Saucier, „Ein Leben mehr“. Insel TB, 10 €
Lesetipp: Sisyphos in Klickpedalen. Joachim Zelters „Im Feld“ ist eine brillante Parabel auf eine Sinnsuche, die die verzweifelte Anstrengung zum Wert an sich erklärt.
Der in Freiburg geborene Joachim Zelter hat sich mit Romanen wie „Briefe aus Amerika“, „Schule der Arbeitslosen“ und „Der Ministerpräsident“ einen Namen gemacht und zahlreiche Preise gewonnen. Doch sein Roman „Im Feld“ lag lange ungelesen bei mir herum. Ein Rennradfahrerroman? Nichts für mich!, war ich mir sicher. Aber einmal begonnen, las ich ihn an einem Tag, unterbrochen von minimalen Pausen zur Nahrungsaufnahme, und hatte mich am Ende nicht nur diesbezüglich tief in den Protagonisten eingefühlt.
Frank Staiger ist frisch nach Freiburg im Breisgau gezogen, ohne so recht zu wissen, warum. Sein Leben ist leer, seine Lebensgefährtin macht sich Sorgen. Sie ist es, die den Hobbyrennradler auf einen Verein aufmerksam macht – und die Parforce-Fahrt beginnt: Unversehens gerät er in eine Gruppe, die alles, aber auch wirklich alles aus sich herausholt. Dem Sog dieser Geschichte zu widerstehen ist auch deshalb so schwer, weil sie ganz unaufdringlich als Parabel erzählt wird: auf Leistungsdruck, Leidenschaft, Verschmelzungssehnsucht, ja auf das Leben überhaupt. Schon das vorangestellte Motto, ein Camus-Zitat aus dem „Mythos von Sisyphos“, zeigt, wo es langgeht: Richtung Sinnsuche in absoluter Sinnlosigkeit. All die gesichtslosen Männer und Frauen, nur nach ihren Markenrädern benannt, sind auf der Flucht, fahren ihren Lebenskrisen davon, reiben sich verzweifelt auf, in dem Glauben, ihre Anstrengung sei ein Wert für sich. Ihr charismatischer Führer Landauer scheint ja mörderische Berge hinauf zu schweben wie eine Wolke. Er schenkt ihnen kleine Momente des (scheinbaren) Erkanntwerdens und beschwört die Gemeinschaft, den „geschlossenen Verband“. Im Gefühl, zu den Erwählten zu gehören, toleriert auch Frank sein zunehmend tyrannisches Verhalten, das keine Pause zulässt, kein Ausscheren. Bis auch die letzten Helden „friedlich fallen“.
Zuvor erinnerte sich der gebildete Akademiker Frank noch wie im Flug an Bernard Shaws „Pygmalion“ als einer Geschichte, in der es um die besondere Kraft der Bildung geht. „Was für eine rührselige, absurde und dumme Geschichte“, urteilt er, keine Pedalumdrehung auslassend. Heute verhalte sich alles genau umgekehrt: Um überhaupt überleben zu können, müsse man sich „entbilden“, „entgeistigen“. Erzählt werden müsse die Geschichte eines Mannes, der seinen Verstand „mit letzter Kraft herauspumpt, herauspedaliert, herausfährt. (…) Habe den Mut, dich deiner eigenen Dummheit zu bedienen!“ Eine tiefschwarze Erkenntnis, der immerhin ein halb versöhnter Schluss folgt.
Joachim Zelter, Im Feld. Roman einer Obsession. Klöpfer & Meyer, 20 €
Lesetipp: „Der Fluch des Blutaltars“, der historische Roman zur Walldürner Wallfahrt von Anne Grießer ist eine spannende, sorgfältig recherchierte Reise in die frühe Neuzeit.
von Dr. Susanne Hartmann, Kulturanthropologin, Autorin, Journalistin
Verschwörungstheorien im alten Kleid
„Der Fluch des Blutaltars“ führt in die Wirren des Dreißigjährigen Krieges und spielt in den Jahren 1619 bis 1626.
Philipp, Abkömmling der Bildhauerfamilie Juncker, erleidet einen folgenschweren Unfall. Er gerät in gefährliche Situationen, welche, davon sei an dieser Stelle nicht zu viel verraten.
Krieg, Hungersnöte und persönliche Motive lässt die Menschen überall Hexenverschwörungen wittern. Selbst Philipps große Liebe Katharina wird angeklagt. Das Zentrum des Historischen Romans zur Walldürner Wallfahrt bildet der Heilig-Blut-Altar, den Zacharias Juncker, Philipps Bruder, gestaltet. Bald findet sich der Altar mit Blut übergossen. Ein fauliger Geruch liegt in der Luft. Sind etwa Hexen am Werk?
Die preisgekrönte Krimi-Autorin und Freiburger Schriftstellerin Anne Grießer versteht es wunderbar, den Leser in Bann zu ziehen. Sie tut das unterhaltsam und informativ zugleich.
Wir ziehen mit dem Helden der Geschichte durch den badischen Odenwald. Wir entsetzen uns mit ihm über die Verbrennung angeblicher Hexen. Wir fürchten, ob er Katharina aus den Fängen der Hexenverfolger retten kann. Wir freuen uns, wenn er unerwartete Freundschaften schließt oder die Frauen ganz neu kennenlernt. Er gerät unter die Landsknechte, versucht sein Glück in Wahrsagerei. Ein Gelehrter nimmt ihn unter seine Fittiche. Seine große Liebe Katharina aber kann er nicht vergessen.
Nicht nur die Welt des Philipp Juncker entfaltet sich vor uns, sondern auch die Welt der Frühen Neuzeit. Eine Zeit, in der Menschen gefoltert und umgebracht wurden, nur weil andere sie der schwarzen Magie bezichtigten. Aber auch eine Epoche, in der die Wissenschaften voranschritten.
Jede Seite des sorgfältig recherchierten Buches nimmt uns mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit.
Anne Grießer, Der Fluch des Blutaltars, Historischer Roman zur Walldürner Wallfahrt. Silberburg Verlag, 336 Seiten, ISBN: 978-3-8425-2139-1, 14,99 €
Lesetipp: Die Anthologie „Bilder einer Ausstellung“ transportiert Mussorgskys Musik in Geschichten, Lyrik und Bilder.
 von Jochen Striewisch
von Jochen Striewisch
Ich mache keinen Hehl daraus: „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky ist für mich neben der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven das klassische Stück schlechthin. Die „Bilder“ und ich haben uns vor zig Jahren gefunden und sind seitdem die besten Freunde. Das spiegelt sich nicht nur in meiner Sammlung von über 40 verschiedenen Einspielungen wider (Klavier, Orchester, Gitarre, Orgel, Jazz…- wobei sie lange noch nicht vollzählig ist), sondern auch darin, dass ich quadratisch im Kreis gesprungen bin, als mich Marianne Labisch zu einer Leserunde einer Anthologie zu „Bilder einer Ausstellung“ eingeladen hat. Okay, ich versuche den Übertreibungsmodus jetzt mal auszuschalten.
Tatsache ist und bleibt jedoch, dass die an der im p.machinery-Verlag erschienenen Anthologie beteiligten Künstler und Autoren (ich schließe hier Künstlerinnen und Autorinnen mit ein), hervorragende Arbeit in Bezug auf die Umsetzung geleistet haben. Die neu entstandenen Bilder sind durchweg große Klasse, transportieren perfekt die Stimmung in die nachfolgenden Lyriktexte von Gerd Scherm oder die den Bildern folgenden Prosatexte. Allerdings hätten die Bilder für meine Begriffe teilweise noch größer sein können. Ich vermag allerdings nicht zu sagen, ob es an dem EBook-Format liegt – einen Vergleich kann ich erst machen, wenn ich die gedruckte Version in Händen halte. Das ist dann aber schon der einzige marginale Kritikpunkt, den ich an dieser Anthologie habe.
Die Geschichten reichen von der Vergangenheit bis in die Gegenwart (teilweise auch beides gleichzeitig), füllen mit ihren Inhalten die ein oder andere Wissenslücke der Leserschaft und lassen diese über die Kraft der Kunst, der Musik und (kritisch) über die immer weiter fortschreitende Hologrammtechnologie („Pas de deux“ von Gabriele Behrend) nachdenken. Hinzu kommen paranormale („Ignoranz stirbt nie“ von Verena Jung) sowie Fantasy- und Horrorelemente („Die Hütte der Baba Jaga“ von Detlef Klewer) und natürlich Humor der feinsten Sorte („Der Plan“ von Marianne Labisch).
Zur Geschichte „Der Weg des Gnomus“ von F.A. Peters gibt es zudem einen separaten Band; (Gnomus oder Der König, der nicht lachte) ebenfalls erschienen im p.machinery-Verlag.
Aufgewertet wird diese wirklich rundum runde Anthologie von einer umfassenden Auflistung von verschiedenen Einspielungen von „Bilder einer Ausstellung“ oder Teilen derselben.
5* deluxe!
Marianne Labisch, Marco Habermann, Gerd Scherm (Hrsg.)
BILDER EINER AUSSTELLUNG
Außer der Reihe 28
p.machinery, 132 Seiten
Paperback: ISBN 978 3 95765 143 3 – EUR 14,90
Hardcover: ISBN 978 3 95765 144 0 – EUR 25,90
E-Book: ISBN 978 3 7438 8153 2 – EUR 7,49
Lesetipp: „Ein anderes Leben findest du allemal“ von Renate Klöppel
von Patrik Schulz
 Nach 25 Jahren Ehe und nach dem Tod ihrer beiden Eltern reist Lisa ziellos durch Deutschland und landet schließlich in einem kleinen, leer stehenden alten Haus im Schwarzwald. Dort findet sie die Muße, ihr vergangenes Leben zu reflektieren, und von dort aus reist sie an die Orte Ihrer Kindheit und Jugend.
Nach 25 Jahren Ehe und nach dem Tod ihrer beiden Eltern reist Lisa ziellos durch Deutschland und landet schließlich in einem kleinen, leer stehenden alten Haus im Schwarzwald. Dort findet sie die Muße, ihr vergangenes Leben zu reflektieren, und von dort aus reist sie an die Orte Ihrer Kindheit und Jugend.
In ihrer Familie, hinter deren heiler Fassade ein gewalttätiger Vater und eine alkoholabhängige Mutter stehen, wendet sich Lisa ihrem älteren Bruder Rudi zu. Der jedoch verlässt die Familie direkt nach dem Abitur und geht seiner Gesinnung folgend in die DDR. Dennoch sollte kein Ehemann oder Geliebter Lisas Leben so nachhaltig bestimmen wie er. Dreizehn Jahre nach seinem Verschwinden steht er vor Lisas Tür. Lisa, die inzwischen in Westberlin wohnt, nimmt ihn auf und versucht alles, um den im Stasi Gefängnis Traumatisierten bei der Bewältigung seines Lebens zu helfen.
Lisa selbst ist auf der Suche nach einem anderen, selbstbestimmten Leben immer wieder gescheitert, nicht zuletzt, weil sie sich Männer aussucht, die sie bevormunden, sie abhängig machen und denen sie sich unterwirft, wie sie als reife Frau erkennt.
Erzählt wird Lisas Geschichte auf dem Hintergrund der Nachkriegszeit, der Wirtschaftswunderzeit und der Gegenwart. Viele sorgfältig recherchierte Details und genaue Beobachtungen machen den Roman lebendig und glaubwürdig. Lesenswert sind auch die Naturbeschreibungen, besonders die des Schwarzwalds.
Renate Klöppel
Ein anderes Leben findest du allemal. Roman.
Wellhöfer Verlag. 14,95€
Lesetipp: „Frauen morden schöner“, Krimianthologie
 Ein Buchtipp von Dr. Susanne Hartmann: Kulturanthropologin, Autorin, Journalistin.
Ein Buchtipp von Dr. Susanne Hartmann: Kulturanthropologin, Autorin, Journalistin.
Gefährliches Territorium
Die Mörderischen Schwestern schlagen wieder zu – ob mit Flaschen, Gift oder gezielten Schüssen. Bei diesen kriminellen Subjekten handelt es sich um den Verein deutschsprachiger Kriminalautorinnen. Die Gruppe aus Baden-Württemberg hat sich verschworen, um uns in Angst und Schrecken zu versetzen. Sie tun das schaurig-schön, überraschen mit wendigen Plots und hinterhältigen HeldInnen.
Da wollen welche ihre Ehemänner um die Ecke bringen und besprechen das beim Gang zur Toilette. Oder eine Kehrschaufel mutiert zum Mordwerkzeug.
Ein Hüftknochen, der gefunden wird, alarmiert eine Gemeinde. Von wem stammt er nur? So manchem Bewohner schlottern die Knie.
Mitunter sorgt ein Verbrechen für ein göttliches Fahrgefühl. Ein Golfplatz verwandelt sich in einen rachedurstigen Tatort. Das Landleben entpuppt sich für eine Krimiautorin als Tortur bis aufs Blut. Selbst ein Messer erzählt von seinen einschneidenden Erlebnissen.
Auch die Freiburger Schriftstellerinnen Anne Grießer und Alexa Rudolph lassen in der Anthologie ihrer mörderischen Fantasie freien Lauf. Bei Alexa Rudolph geht es saumäßig spannend zu, wie schon in ihrem Kriminalroman „Das Schweigen der Schweine“ und ihrem neuesten Fall „Der letzte Spargel“. Anne Grießer ist vielen bekannt durch ihre Krimi-Shows und zahlreichen Veröffentlichungen, wie ihren Roman „Das Heilige Blut“.
„Frauen morden schöner. 25 kriminelle Geschichten aus Baden-Württemberg.“ Hrsg.: Mareike Fröhlich. Wellhöfer Verlag 2018. 12,95 €. ISBN: 978-3-95428-248-7
Lesetipp: Manuela Fuelles Roman „Fenster auf, Fenster zu“ vereint eine besondere Begabung für Ironie mit sensibler Genauigkeit.
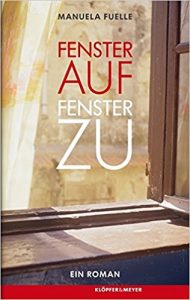 Im letzten Jahr hat sie für ihren jüngsten Roman „Luftbad Oberspree“ den Thaddäus-Troll-Preis bekommen. Aber auch ihr Erstling, „Fenster auf, Fenster zu“, hätte einen dicken Preis verdient gehabt. Diese Geschichte einer Vatersuche vereint so viel Experimentierfreude, sensible Genauigkeit und nicht zuletzt eine besondere Begabung für Ironie und Humor, dass das Lesen auf jeder Seite einfach nur Spaß macht.
Im letzten Jahr hat sie für ihren jüngsten Roman „Luftbad Oberspree“ den Thaddäus-Troll-Preis bekommen. Aber auch ihr Erstling, „Fenster auf, Fenster zu“, hätte einen dicken Preis verdient gehabt. Diese Geschichte einer Vatersuche vereint so viel Experimentierfreude, sensible Genauigkeit und nicht zuletzt eine besondere Begabung für Ironie und Humor, dass das Lesen auf jeder Seite einfach nur Spaß macht.
Die in Ost-Berlin geborene, jetzt in Freiburg lebende Autorin erzählt darin von einer Tochter, die sich eher unwillig auf die Suche nach ihrem verschwundenen Vater macht. Ihre Schwestern sorgen sich und sind überzeugt von seiner Demenz. Sie selbst jedoch kennt seine – und ihre eigene – Eigenwilligkeit zu gut, um an dieses Erklärungsmuster zu glauben. Während sie sich dem ländlichen Hof nähert, in dem sie ihn vermutet, erinnert sie sich an ihre außergewöhnliche Kindheit mit dem alleinerziehenden Vater, die mal hoch belastet, mal auch paradiesisch frei und wild gewesen sein muss. Das Vater-Tochter-Doppelporträt zeichnet zwei Menschen, die sich gesellschaftlichen Regeln und „normalen“ Denkstrukturen weder unterordnen wollen noch können.
Die abgebrochenen Sätze, ungestümen Assoziationsketten, dann wieder lyrisch introvertierten Passagen machen es manchem Leser vielleicht nicht leicht – und doch kann man sich von dieser Sprache eigentlich ganz einfach tragen lassen. Erstaunlich, dass so schwere Themen so schwerelos behandelt werden können. Die Ich-Erzählerin bringt es auf den Punkt: „Ich glaube, nur Autoren, die ihre Leser zum Lachen bringen, meinen es wirklich ernst.“
Manuela Fuelle, Fenster auf, Fenster zu. Ein Roman. Klöpfer & Meyer, 19,90 €.
Lesetipp: „Kleins große Sache“ von Daniela Engist. Eine erhellende Satire aus der globalen Welt aufgeblasener Wichtigkeiten.
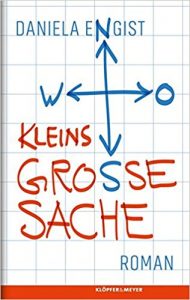 „Management ist im Grunde nichts anderes als unablässiges Geschichtenerzählen. Den lieben langen Tag müssen Manager Sinn stiften anhand von Textbausteinen, die ihnen zufällig hingeworfen werden. (…) Erst wenn dem Erzähler am tausendundersten Tag die Geschichten ausgehen, wird er geköpft.“
„Management ist im Grunde nichts anderes als unablässiges Geschichtenerzählen. Den lieben langen Tag müssen Manager Sinn stiften anhand von Textbausteinen, die ihnen zufällig hingeworfen werden. (…) Erst wenn dem Erzähler am tausendundersten Tag die Geschichten ausgehen, wird er geköpft.“
Harald Klein, Protagonist und Denker dieser Zeilen, ist studierter Philosoph und eigentlich der Meinung, dass er es nicht weit bringen wird. Aus einer Trotzreaktion heraus bewirbt er sich bei einen Schweizer Großkonzern und macht dort tatsächlich Karriere – auch wenn die zur Reise durchs wilde Absurdistan gerät. Anfangs distanziert, identifiziert er sich zunehmend mit der „Großen Sache“, einer Firmenideologie, deren Ausdrucksformen nicht zufällig vielfache Ähnlichkeiten mit Sekten, aber auch totalitären Regimen aufweist.
Daniela Engist ist Insiderin, das merkt man dieser Satire an. Ihr Romandebut hat sie nach einer langen Phase der PR-Arbeit für multinationale Konzerne geschrieben. Sie beherrscht das Spiel mit Stilen und Formen und charakterisiert ihre Figuren gekonnt. Die Faszination des Elitären, die Zauberkraft von Design, Luxus, Statussymbolen und aufgeblasenen Titeln wird sehr deutlich. Zahlreiche Bilder für die erschreckende Leere hinter all der aufgeblasenen Wichtigkeit finden am Ende ihren Höhepunkt im Zusammenbruch des Konzerns. Dass auch ein zufälliges Erdbeben noch seinen Beitrag dazu leisten muss, wäre eigentlich nicht nötig gewesen.
Daniela Engist, Kleins große Sache. Roman. Klöpfer & Meyer, 25 €.
Lesetipp: „Wie ist das so, wenn man so alt ist?“ Jess Jochimsen erzählt es uns, in seinem neuen Roman „Abschlussball“.
von Sylvia Schmieder
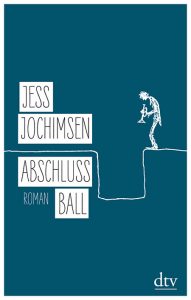 Wie schon „Was sollen die Leute denken“ ist auch dieser Roman eine Erzählung von einem, der nicht normal funktioniert, obwohl er es eigentlich möchte. Diesmal ist aber alles noch viel komplizierter. Und wer vom Kabarettisten Jess Jochimsen ein komisches Buch erwartet, wird diesmal erst recht enttäuscht. Oder auch wieder nicht. Nachdenklich, langsam, fast ungelenk und zum Heulen skurril tappt der Ich-Erzähler durch seine Geschichte, die nicht nur in den Münchner Schauplätzen und der Titelillustration an Karl Valentin erinnert. Ein Entwicklungsroman der anderen Art.
Wie schon „Was sollen die Leute denken“ ist auch dieser Roman eine Erzählung von einem, der nicht normal funktioniert, obwohl er es eigentlich möchte. Diesmal ist aber alles noch viel komplizierter. Und wer vom Kabarettisten Jess Jochimsen ein komisches Buch erwartet, wird diesmal erst recht enttäuscht. Oder auch wieder nicht. Nachdenklich, langsam, fast ungelenk und zum Heulen skurril tappt der Ich-Erzähler durch seine Geschichte, die nicht nur in den Münchner Schauplätzen und der Titelillustration an Karl Valentin erinnert. Ein Entwicklungsroman der anderen Art.
Marten, Beerdigungstrompeter und auch sonst dem Leben deutlich abgewandt, gerät in Turbulenzen, als er die Bankkarte seines verstorbenen Klassenkameraden findet. Mit ihrer Hilfe tritt er in einen seltsamen Dialog mit dem Toten ein, der ihn verändert. Er hat sich schon als Kind alt gefühlt, jetzt verliebt er sich wie ein Teenager in eine Frau, die er schon ewig kennt und macht auch sonst nur Dummeiten – bis zum Zusammenbruch, der zum Glück kein endgültiger ist. Gerahmt werden die sechs Romanteile durch gekonnt lockere, lyrische Passagen, die sich am Ende als Antworten an die neunjährige Trompetenschülerin Anne herausstellen. Ganz wie einst ihr Lehrer hat sie noch keine einzige Note geblasen und weigert sich, das Instrument auch nur anzufassen. Stattdessen stellt sie eine nur scheinbar einfache Frage: „Wie ist das so, wenn man so alt ist?“
Jess Jochimsen, Abschlussball. Roman. dtv, 20 €
http://jessjochimsen.de
Lesetipp: Fast-Read-Romane für Zeitverschwender. Die Kurzgeschichten im Band „Zeitweichen“ von François Loeb laden zur geduldigen Lese-Bummelei.
von Sylvia Schmieder
 Der Autor François Loeb hat eine bewegte Vergangenheit: Von 1975 bis 2005 leitete er das Berner Traditionskaufhaus Loeb. Nach politischen Mandaten gehörte er von 1987 bis 1999 dem Schweizer Nationalrat an. In den 80er Jahren begann er seine Laufbahn als Autor mit den ersten „Fast-Read-Romanen“, die er in der Neuen Züricher Zeitung veröffentlichte. Heute lebt und schreibt er im Schwarzwald.
Der Autor François Loeb hat eine bewegte Vergangenheit: Von 1975 bis 2005 leitete er das Berner Traditionskaufhaus Loeb. Nach politischen Mandaten gehörte er von 1987 bis 1999 dem Schweizer Nationalrat an. In den 80er Jahren begann er seine Laufbahn als Autor mit den ersten „Fast-Read-Romanen“, die er in der Neuen Züricher Zeitung veröffentlichte. Heute lebt und schreibt er im Schwarzwald.
In seinen neuen Geschichten spielt er das Thema „Zeit“ in über neunzig Texten durch. Mal kurzweilig, mal skurril, geheimnisvoll oder poetisch beschäftigt er sich mit Zeitkäfern, der Eiszeit oder dem Zeittotschlag. So zahlreiche Texte zu durchforsten dauert seine Zeit, und manchmal stolpert der Zeitreisende über sprachliche Unsauberkeiten, die ein sorgfältiges Lektorat hätte korrigieren müssen. Doch ein bisschen Geduld lohnt sich, zum Beispiel für eigentümliche Charakterstudien wie „Der Uhrenfreund“ oder die Kurzgeschichte „Die Uhrzeit“, in der eine alltägliche Frage seltsame Verwicklungen nach sich zieht.
François Loeb, Zeitweichen.
Fast-Read-Romane.
Allitera Verlag, 14,80 €
Lesetipp: „Billy“ von einzlkind. Gescheit und umwerfend witzig geschriebener Thriller um einen schottischen Auftragskiller mit Vorliebe für die Philosophie Nietzsches.
von Jess Jochimsen, Kabarettist, Autor, Fotograf, siehe http://www.jessjochimsen.de.
 Bei meinem zweiten absoluten Lieblingsbuch 2016 wusste ich schon vor der Lektüre, dass ich Spaß und Freude haben würde, aber mit einem derartig großartigen Ritt hätte ich nicht gerechnet.
Bei meinem zweiten absoluten Lieblingsbuch 2016 wusste ich schon vor der Lektüre, dass ich Spaß und Freude haben würde, aber mit einem derartig großartigen Ritt hätte ich nicht gerechnet.
Schon in seinen ersten beiden Romanen hat der Mann bewiesen, dass er der mit Abstand coolste und lustigste Autor deutscher Zunge ist – mit den bekannten Folgen: Huldigungen vom abseitigen Musik-Fanzine bis hin zu Hans Magnus Enzensberger, Bestsellerstatus und wildeste Spekulationen darüber, wer hinter dem Pseudonym „einzlkind“ stecken könnte. Wahr ist, dass das Debut Harold (2010) das erste unverlangt eingesendete Manuskript war, das in der fast 40jährigen Verlagsgeschichte der feinen „Edition Tiamat“ tatsächlich gedruckt wurde und wahr ist weiter, dass der hochverehrte Klaus Bittermann dieses Buch (ebenso wie den Nachfolger Gretchen von 2013) mit Liebe, Chuzpe und Verschwiegenheit zu Erfolg und Ehren führte und nun zu Recht etwas traurig über den Verlagswechsel sein darf. Allerdings ist auch dies die verdammte Wahrheit: Billy übertrifft nicht nur die hohen Erwartungen, sondern sogar seine Vorgänger. Erzählt wird die Geschichte eines schottischen Auftragskillers mit Vorliebe für die Philosophie Nietzsches, der durch die Welt geschickt wird, um Mörder zu ermorden. Wie es sich für einen „hardboiled Krimi“ gehört, lässt er sich von den Opfern vorab deren Lebensgeschichte erzählen und gönnt ihnen einen letzten Musikwunsch. Wie es sich ebenfalls gehört, läuft irgendwann alles aus dem Ruder und Billy wird selbst zum Gejagten. Fulminanter Showdown inklusive. In Las Vegas. Wo sonst.
Diese „pulp fiction“ ist allerdings derart gescheit und umwerfend witzig gebaut, dass man einem der integersten Literaturkritiker dieses Landes, Prof. Erhard Schütz, nur beipflichten kann, wenn er im MAGAZIN konstatiert: „Alles in allem haben wir es mit einem atemberaubend einfallsreichen, sprachlich feinst gelungenen, zugleich abgründig intelligenten Thriller zu tun.“
Ich würde gar weitergehen und behaupten: Gesetzt den Fall, dass Quentin Tarantino je einen Storyliner oder Dialogautor für seine Filme anheuern wollte, er hätte beide schon gefunden; in Personalunion des „geheimnisvollen Bestsellerautors einzlkind“ (Süddeutsche Zeitung), der sich im Gegensatz zu den selbstdarstellenden Pointendrechslern hierzulande angenehmst zurückhält und nichts als seine Texte für sich sprechen lässt. „PENG!“
einzlkind, Billy. Roman. Insel Verlag, 18,95 €
Lesetipp: Skurriles mit Bodenhaftung. In Roland Krauses „Hurenballade“ ziehen die Figuren den Leser mit ungeheurer Kraft mitten in besondere Umstände.
von Renate Schauer , Journalistin, siehe http://memo-reporting.com/ und Blog > Medien & querbeet
 Hurenballade umfasst dreizehn Stories: unverwechselbare Typen, packende Schilderungen, überraschende Wendungen – Roland Krause weiß Abgründe auszuleuchten und sein Lesepublikum in den Bann zu ziehen. Das Skurrile scheint zum Alltag zu gehören wie die Brotzeit und die Bettdecke.
Hurenballade umfasst dreizehn Stories: unverwechselbare Typen, packende Schilderungen, überraschende Wendungen – Roland Krause weiß Abgründe auszuleuchten und sein Lesepublikum in den Bann zu ziehen. Das Skurrile scheint zum Alltag zu gehören wie die Brotzeit und die Bettdecke.
Die Charaktere und Schauplätze könnten in jeder Gegend/Stadt so zu finden sein. Die Auswahl lässt erahnen, dass „die verrücktesten Geschichten nur einen Augenblick entfernt sind“ (Klappentext). Die Protagonisten stehen nicht auf der Sonnenseite des Lebens, sind aber auch keine „Loser“, sondern auf der Suche nach Verständnis, Nähe oder Glück. Sie verlieren Illusionen, erfahren Ernüchterung, werden betrogen oder müssen ihren Hund heimlich begraben. Beim einen ist das Haltbarkeitsdatum seines Kondoms abgelaufen, was zu einer abenteuerlichen Odyssee führt; beim anderen wird kurz vorm Sprung die Lebensmüdigkeit vertrieben, weil jemand gezündelt und seinen Stadel in Brand gesetzt hat. Zuletzt hat man Vielschichtiges erfahren, nicht nur in der Situation mitgefiebert.
Man wird Zaungast von Niederungen, die einem der eigene Nachbar nie eingestehen würde, aber trotzdem durchgemacht haben könnte. Denn alle Figuren könnten als „Normalbürger“ durchgehen, gerieten sie nicht in diese besonderen Umstände und wäre da nicht die Dichte, in der die Szenen erzählt sind, was dann eben doch daran erinnert, dass hier gekonnt spannende Unterhaltung konstruiert wird.
Sprachbilder: Fast zwingend sind sie in der Regel angelegt, damit man die Figuren so auffasst wie der Autor sie meint. Der Leser, die Leserin wird gepackt und gerät mit der Nase in die kürzest mögliche Distanz zum Milieu und zum Geschehen, das fast immer plausibel wirkt. Und der Blickwinkel des Protagonisten ist mit hoher Authentizität unterlegt. Kraftausdrücke und zartfühlende Momente inbegriffen.
Roland Krause: Hurenballade. Dreizehn Stories. Balaena Verlag, Landsberg am Lech 2016. 200 Seiten, 17,90 EUR. ISBN-13: 9783981266160
Lesetipp: Irrwitz und Doppelbödigkeit, überraschende Bilder und ambivalente Charaktere machen Graham Greenes „Unser Mann in Havanna“ heute noch lesenswert.
 Vor allem zahllose Filme aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren, in deren Abspann er als Drehbuchautor oder Autor der Buchvorlage genannt wird, haben Graham Greene berühmt gemacht. Aber lohnt es sich heute, ihn zu lesen? Ein klares Ja! Und zwar auch dann, wenn man, wie ich, weder Krimis noch Spionageromane zu seiner bevorzugten Lektüre zählt.
Vor allem zahllose Filme aus den Fünfziger- und Sechzigerjahren, in deren Abspann er als Drehbuchautor oder Autor der Buchvorlage genannt wird, haben Graham Greene berühmt gemacht. Aber lohnt es sich heute, ihn zu lesen? Ein klares Ja! Und zwar auch dann, wenn man, wie ich, weder Krimis noch Spionageromane zu seiner bevorzugten Lektüre zählt.
Kuba, kurz vor der Revolution. Held und Antiheld des Romans ist der Engländer James Wormold, der als alleinerziehender Vater einer Siebzehnjährigen in Havanna lebt. Als Staubsaugervertreter verdient er deutlich weniger Geld, als seine Tochter für ihren aufwändigen Lebensstil ausgeben möchte. Als der britische Geheimdienst ihm eine lukrative Spionagetätigkeit anbietet, kann er nicht wirklich ablehnen – obwohl er weder Lust aufs Abenteuer noch die nötigen Kenntnisse hat. Doch bald schon fordert London Ergebnisse. In seiner Verzweiflung zerlegt er einen Staubsauger, zeichnet einzelne Teile ab, ändert den Maßstab und gibt das Ganze als komplexe militärische Anlage aus, die er im Urwald entdeckt haben will. Der gerüchteumwitterte „Chef“ ist begeistert und lässt ihm weitere Gelder und Personal zukommen. Wormold verleitet das zu immer irrwitzigeren Lügenkonstruktionen …
Ein spannender Spionageroman, der eigentlich keiner ist, sondern eine doppelbödige Satire. Immer wieder wird die Macht der Erfindung, der (auch böse) Zauber der Fantasie thematisiert. Immer wieder verblüffte mich die Kraft und Ungewöhnlichkeit der Sprachbilder, die scheinbar ganz leicht daherkommen. Die nihilistische Haltlosigkeit der Charaktere, die zwischen Versagen und Heldentum, Schwäche und Stärke hin und her geworfen werden, wird nur ein wenig ausgeglichen durch den Glauben an Liebe und Treue, der der Geschichte immerhin ein halbes Happy-End beschert.
Graham Greene, Unser Mann in Havanna. dtv, 9,90 €.
Der Urlaubs-Lesetipp von Jess Jochimsen: William E. Bowmans „Die Besteigung des Rum Doodle“ ist ein wahnsinniges Wunderwerk.

Jess Jochimsen, ©Albert J. Schmidt
von Jess Jochimsen, Kabarettist, Autor, Fotograf, siehe http://www.jessjochimsen.de.
Ich riskiere es, Eulen nach Athen zu tragen und mich in die Gesellschaft von Elke Heidenreich und Jürgen von der Lippe zu begeben, welche dieses, zur unbedingten Lektüre anempfohlene, Schriftgut (anlässlich der Taschenbuchausgabe) in den Himmel hoben. Eine „Wiederentdeckung“, ein „Kultbuch“, so konnte man hören. Ich würde eher sagen: ein wahnsinniges Wunderwerk.
Es mag sein, dass diese Geschichte noch zwerchfellerschütternder ist, wenn man weiß, dass sie bereits 1956 geschrieben wurde, nur drei Jahre nach der Erstbesteigung des Mount Everest, zu einer Zeit also, in der Bergsteigen so etwas wie die „Fortführung des Krieges mit anderen Mitteln“ war. Wurden in den 1930er und 40er Jahren noch die Alpen propagandistisch ausgeschlachtet, so verlagerte man nach dem Krieg die hochalpinen Aktivitäten in den Himalaya. Als „Schicksalsunternehmungen nationaler Tragweite“ bezeichnet das der Reisejournalist Andreas Lesti in seinem klugen Nachwort und weist darauf hin, dass „jede Nation ihren eigenen Schicksalsberg“ hatte (die Engländer den Mount Everest, die Deutschen den Nanga Parbat, die Italiener den K2 und die Franzosen den Annapurna). Kurzum: In dieser Dekade sind „Expeditionen […] Feldzüge und Bergsteiger Soldaten – und die Berichte darüber sind humorlos, ernst und unerträglich.“ (A. Lesti)
Und dann kommt dieser englische Ingenieur daher und schreibt in seiner Freizeit ein Buch, das in puncto Witz – bis heute – alles in den Schatten stellt, was nicht bei drei auf dem Gipfel ist. Die Besteigung des Rum Doodle ist die Geschichte einer (fiktiven) Himalaya-Expedition, bei der alles, aber auch wirklich alles schief geht, was schiefgehen kann. Man kann sich beim Lesen nicht dagegen wehren, bei den Expeditionsteilnehmern ständig die Mitglieder von „Monty Pythons Flying Circus“ vor Augen zu haben: den Navigator, der trotz Kompass noch nicht mal zum ersten Treffpunkt findet, den Arzt, der dauernd krank ist, den unter Antriebslosigkeit leidenden Hauptkletterer, den (englischen!) Koch, dessen Qualitäten jeder Beschreibung spotten, und den Übersetzer, der die Sprache der Einheimischen nicht versteht, weswegen er 30.000 statt 3.000 Träger engagiert … Und am Ende haben haben sie auch noch den falschen Berg bestiegen!Bill Bryson, der wahrscheinlich beste (und mit Sicherheit humorvollste) Reiseschriftsteller der Welt fällte vor fast auf den Tag genau 15 Jahren ein Urteil, das bis zum unwahrscheinlichen Beweis seines Gegenteils Gültigkeit besitzt: Die Besteigung des Rum Doodle ist „das lustigste Buch, das Sie jemals lesen werden.“
William E. Bowman, Die Besteigung des Rum Doodle, Goldmann Verlag, 9,99 €
Lesetipp: Thommie Bayer, Weißer Zug nach Süden. Eine leichte, nachdenkliche Geschichte über Seelenverwandtschaft und Inspiration, Phantasie und Wirklichkeit.
Lesetipp von Patrik Schulz
 Im Mittelpunkt des Romans steht die besondere Beziehung zwischen Chiara und Herrn Vorden. Chiara putzt die Wohnung von Herrn Vorden in Vertretung ihrer Freundin Leonie, bekommt ihn allerdings nie zu Gesicht. Außer Schokolade und Obst für Chiara liegen auch immer neue Computerausdrucke mit Geschichten auf dem Schreibtisch in seiner Wohnung. Chiara liest diese Geschichten und ist zunächst irritiert, da sie Bezüge zu ihren Denken und Handeln enthalten. Sind in der Wohnung versteckte Kameras, über die Herr Vorden Chiara beobachtet? Chiara findet keine, und mit der Zeit verwandelt sich die Irritation in Sympathie. Sie empfindet eine Seelenverwandtschaft mit Herrn Vorden und verliebt sich unbekannterweise ein wenig in ihn.
Im Mittelpunkt des Romans steht die besondere Beziehung zwischen Chiara und Herrn Vorden. Chiara putzt die Wohnung von Herrn Vorden in Vertretung ihrer Freundin Leonie, bekommt ihn allerdings nie zu Gesicht. Außer Schokolade und Obst für Chiara liegen auch immer neue Computerausdrucke mit Geschichten auf dem Schreibtisch in seiner Wohnung. Chiara liest diese Geschichten und ist zunächst irritiert, da sie Bezüge zu ihren Denken und Handeln enthalten. Sind in der Wohnung versteckte Kameras, über die Herr Vorden Chiara beobachtet? Chiara findet keine, und mit der Zeit verwandelt sich die Irritation in Sympathie. Sie empfindet eine Seelenverwandtschaft mit Herrn Vorden und verliebt sich unbekannterweise ein wenig in ihn.
„Phantasie und Wirklichkeit sind manchmal wie Zahnräder, die ineinander greifen um dasselbe zu bewegen.“, heißt es in einem Satz im vorletzten Kapitel. Diese Zahnräder bewegen einen unterhaltsamen und nachdenklichen Roman – genau das richtige fürs Reisegepäck.
Thommie Bayer, Weißer Zug nach Süden. Piper Verlag, 16,99 €
Am 13.August liest Thommie Bayer aus diesem Roman, in der Vorderhaus-Reihe „Unter Sternen“ im Innenhof der Spechtpassage“!
Lesetipp: „Man lacht und man weint …“ Selim Özdogan, Wieso Heimat, ich wohne zur Miete.
von Jess Jochimsen, Kabarettist, Autor, Fotograf, siehe http://www.jessjochimsen.de.
Dass Selim Özdogan seit nunmehr zwanzig Jahren zu den begnadetsten und produktivsten Romanciers und Geschichtenerzählern in diesem Land gehört, sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Nun zeigt er, dass er auch in den Olymp der Satiriker gehört. Man lacht und man weint beim Lesen des neuen Romans und erfährt viel über Deutschland und die Türkei, über Erdogan und den Gezi-Park, über Vorurteile, Klischees und religiöse Zuschreibungen. Hier zeigt einer endlich mal, wie das geht, sich abseits des großen „Islamismus“-Schlachtfeldes aufzuhalten und dennoch Haltung zu bewahren. Ein grandios kluges und grandios komisches Buch!
Selim Özdogan, Wieso Heimat, ich wohne zur Miete, Haymon Verlag, 19,90 €
Am 12. August liest Özdogan aus „Wieso Heimat, ich wohne zur Miete“ in der Vorderhaus-Reihe „Unter Sternen“ im Innenhof der Spechtpassage“!
Lesetipp: Horror vom Feinsten macht sich breit in den Geschichten aus der Regio.
Ein Lesetipp von Susanne Hartmann, Autorin und Journalistin, Freiburg.
Wussten Sie, dass es im Schwarzwald spukt? Dass Gespenster im Breisgau ihr Unwesen treiben? Und selbst vor Freiburg nicht Halt machen? Und zwar so toll, dass 24 Autorinnen und Autoren aus der Regio Ihnen davon erzählen müssen. Geben Sie Acht, wenn Sie in den Reben spazieren gehen. Sonst holen Sie die Geister ein. Möglicherweise geraten Sie unversehens in eine andere Zeit. Oder etwas kommt daraus zu Ihnen. Vielleicht gehören Sie selbst schon zu den Gespenstern und haben es noch gar nicht gemerkt? Wie weiland im Film „Der sechste Sinn“. Und Vorsicht, so ein Gespenst kann sich übel rächen. Als schöne Hexe verführt es mitunter einen Drachenflieger zu waghalsigen Flugmanövern. Was alles hinter diesen Geistwesen steckt, zeigen uns die Autoren auf höchst unterschiedliche Weise. Mal grauenerregend, mal mystisch, mal zum Schmunzeln.
Anne Grießer & Sascha Berst-Frediani (Hg.): Breisschauer. Gruselkrimis und Unheimliches aus Südwest. Wellhöfer Verlag. 11,90 €.
Geschichtsbuch, Fundgrube, Kaleidoskop: Irene Ferchls Text- und Bildband „Über das Land hinaus. Literarisches Leben in Baden-Württemberg“ bietet reichlich Lesestoff für Erinnerungs- und Entdeckungsfreudige.
Ein Lesetipp von Sylvia Schmieder, Autorin, Journalistin, siehe www.sylviaschmieder.de.
Dieser Band hat es in sich – auch wenn er äußerlich unscheinbar daherkommt. Sieben ausführliche, chronologisch fortschreitende Kapitel zeichnen unsere Literaturgeschichte nach, von der Gründung Baden-Württembergs in den Fünfzigerjahren bis heute. Doch den besonderen Reiz dieses „Geschichtsbuchs“ macht die Vielfalt seiner Darstellungsmittel aus: literarische Texte, Essays, Interviews, Reportagen, Porträts, zahlreiche Schwarzweißbilder mit ausführlichen Legenden … Eine spannende Fundgrube, die Lesestoff für viele, lange Sommerabende bietet. Nicht nur die großen Namen, auch tapfere Einzelkämpfer und Fast-schon-Vergessene werden gewürdigt. Es entsteht ein differenziertes Bild der Literaturszene, das Seite für Seite neue Entdeckungen bereithält.
Die Autorin ist Gründerin, Herausgeberin und Chefredakteurin des „Literaturblatt für Baden-Württemberg“, hat Literaturfestivals organisiert, literarische Reiseführer verfasst und mehrere Anthologien herausgebracht.
Irene Ferchl: „Über das Land hinaus. Literarisches Leben in Baden-Württemberg.“ Klöpfer & Meyer, 34 Euro.
Demnächst neu: Alexa Rudolph, „Das Schweigen der Schweine“. Schwarzwaldkrimi mit einem Kommissar im Rollstuhl und einem hitzköpfigen Landwirt.
In einem Schwarzwalddorf geschieht Besorgniserregendes: ein Kind wird entführt, einem Schaf fehlt der Kopf, ein Hühnerfuß liegt in der Wäsche und die Bäuerin schließlich tot im Stall. „Frech, raffiniert und ziemlich böse“ kündigt der Emons Verlag den neuen Krimi der Freiburgerin Alexa Rudolph an, der im Juli dieses Jahres erscheinen wird.
Alexa Rudolph, Das Schweigen der Schweine. Schwarzwaldkrimi. Emons Verlag, 11,90 Euro.
Lesetipp: Gnadenlos sensibel. Die Erzählungen in „Fünf Witwen“ von Evelyn Grill bieten furchtbare Lesefreuden.
Ein Lesetipp von Sylvia Schmieder, Autorin, Journalistin, siehe www.sylviaschmieder.de.
Die in Freiburg lebende Evelyn Grill ist in Österreich aufgewachsen und hat sich bereits seit den Achtzigerjahren einen Namen als Autorin intelligenter, gern auch abstruser Romane mit dunklem Humor gemacht. Mit „Fünf Witwen“ erschien 2015 ein Band mit neun Erzählungen, die ein Rezensent nicht zu Unrecht als „depressive Satiren“ bezeichnet hat. Für Leser, die vor den Abgründen menschlicher Erfahrungen nicht zurückschrecken, gerade deshalb eine lohnende Lektüre. Grills sensible, vielschichtige Sprache und kunstvolle Erzählweise machen Freude, selbst wenn es um Furchtbares geht.
Evelyn Grill, Fünf Witwen, Erzählungen. Haymon Verlag 2015.
